Die Corona-Pandemie jährt sich und damit der Beginn von Lockdowns, Home-Uni und Kontaktbeschränkungen. Regulierungen, die natürlich alle von uns in sämtlichen Bereichen treffen – über die Universitäten und Studierenden wurde dabei aber in den letzten 13 Monaten selten bis gar nicht gesprochen. Dabei ist es an der Zeit, Lösungen abseits von Zoom zu finden, um ihre psychischen Belastungen zu lindern.
Sind Studierende am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen? – Nein, natürlich nicht. Durch sie zeigen sich vielmehr die sozialpolitischen Versäumnisse der letzten Jahrzehnte und die Prioritäten der aktuellen Politik wie unter einem Brennglas. Denn im letzten Jahr mussten Inhaber*innen von kleineren Unternehmen um ihre Existenz kämpfen, sozial benachteiligte Kinder wurden noch weiter abgehängt und Alleinerziehende gerieten durch die Schulschließungen stärker unter Druck. Von den Nothilfen konnten diese Entwicklungen nur bedingt abgefedert werden; auch weil es teilweise an der Auszahlung scheiterte.
Währenddessen stimmte der Cashflow in der Politik und bei Großkonzernen scheinbar. Denn einige Abgeordnete halfen in der Krise vor allem sich selbst, indem sie durch die Vermittlung von Maskendeals sechsstellige Summen kassierten. Gesundheitsminister Spahn musste für ein sattes Plus auf dem Konto nicht mal soweit gehen, sondern verdiente sich sein Taschengeld bei einem Abendessen mit Unternehmern. Und Autokonzerne wie VW, Daimler und BMW schütteten trotz der staatlich subventionierten Kurzarbeit, die sie in Anspruch nehmen, großmütig Dividenden an ihre Aktionäre aus.
Das sind Probleme, die strukturell verankert sind und an denen dringend etwas geändert werden muss – und das nicht erst seit Corona.
Das Hauptproblem sind nicht fehlende Partys
Trotzdem sollten die Situation und die Sorgen der Studierenden neben all dem nicht totgeschwiegen werden, wie es in den letzten 13 Monaten passiert ist. Bei dem einzigen Online-Bürgerdialog mit Studierenden im Dezember 2020 wirkte Kanzlerin Merkel selbst so, als ob sie sich noch keine zwei Gedanken zu dem Thema gemacht hätte. „Wenn das mit dem Impfstoff klappt, haben wir ja ‘ne relativ große Hoffnung, dass wir zum Herbstsemester hin, wieder mehr Normalität haben könnten“, war noch das optimistischste, was die Regierungschefin da über die Lippen brachte. Leider klappt das mit dem Impfstoff momentan gar nicht und selbst wenn, dauert es bis zum Herbstsemester immer noch ein halbes Jahr. Seit dem Bürgerdialog im Dezember kamen Verschärfungen, Lockerungen, Neuregelungen, Öffnungspläne und Notbremsen. Nichts davon tangierte Universitäten, denn diese tauchten in keinem öffentlichen, politischen Diskurs mehr auf.
Dabei ist das Hauptproblem vieler Studierenden nicht – wie oft dargestellt –, dass sie wieder in Clubs und Bars gehen wollen oder zumindest auf einen kleinen Rave. Studierende sind keine homogene Gruppe. Darunter gibt es Alleinerziehende oder solche die den Großteil der Erziehungsarbeit übernehmen. Viele sind zudem auf Minijobs angewiesen, die pro gearbeitete Stunden bezahlt werden. Sie sind seit dem Beginn der Pandemie vor einem Jahr rar geworden. Ein Blick auf die Konjunkturprognosen verrät, dass sich das mit deren Ende vermutlich auch nicht unmittelbar ändern wird. Hilfen werden allerdings nur ausgezahlt, wenn man nachweisen kann, wegen Corona weniger als 500 Euro auf dem Konto zu haben – was ungefähr. der Monatsmiete für ein WG-Zimmer in Berlin entspricht und damit relativ knapp bemessen ist. Zu den materiellen Sorgen kommen psychische Belastungen, wegen Sorgen um Familienangehörige, die der Risikogruppe angehören und wegen der andauernden Isolation.
Im 15-Quadratmeter-WG-Zimmer lässt es sich schwer ausspannen
Das sind psychische Belastungen, von denen Studierende sich nicht ablenken können, wenn sie den ganzen Tag in denselben 15 Quadratmetern des eigenen WG-Zimmers oder alleine in ihrer Ein-Zimmer-Wohnung verbringen. Denn wenn das Bett nur zwei Meter vom Schreibtisch entfernt steht, der mittlerweile gleichermaßen als Vorlesungssaal und Home-Office-Space fungiert, lässt es sich nur schwer ausspannen. Besonders wenn dann wegen der Kontaktbeschränkungen auch noch der Austausch mit Freund*innen und der Familie fehlt. Da stimmt es auch nicht gerade hoffnungsvoll, dass die meisten von uns wahrscheinlich – und verständlicherweise – am Ende der Impfprioritätsliste stehen, deren Durchführung sich aufgrund von Lieferproblemen und verpatzter Impfkampagnen immer weiter nach hinten verschiebt.
Nachdem nun also immer mehr Studierende von psychischen Problemen berichten und das auch von Studien und einem Anstieg der Inanspruchnahme von Beratungsangeboten in den letzten 13 Monaten untermauert wird, ist es an der Zeit, Lösungen zu finden. Dabei steht außer Frage, dass an einen Normalbetrieb ab dem Sommersemester nicht gedacht werden kann. Die Infektionslage lässt das schlicht nicht zu. Aber warum unter Einbezug von Studierenden und der Universitätsleitung mit Rücksicht auf das Pandemiegeschehen nicht über mögliche, kreativere Lösungen als Zoom gesprochen und ein Konzept ausgearbeitet wird, ist mir schleierhaft. Dass die Bereitschaft unter Studierenden dafür da ist, zeigt auch die Initiative #NichtNurOnline. Denn für viele können Präsenzveranstaltungen und die damit verbundenen sozialen Interaktionen – neben niedrigschwelligen materiellen Hilfen und Beratungsangeboten – ein wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit sein.
Das scheint auch langsam bis zur Uni-Leitung durchgesickert zu sein, die in einer Rund-E-Mail von Mitte März Bemühungen in diese Richtung angelobte.



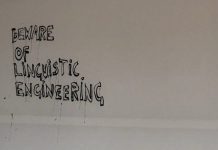





[…] Aktion startet mit einem nachgespielten Zoom-Call. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich ein solches Gespräch vor Augen zu führen. Die […]
Comments are closed.