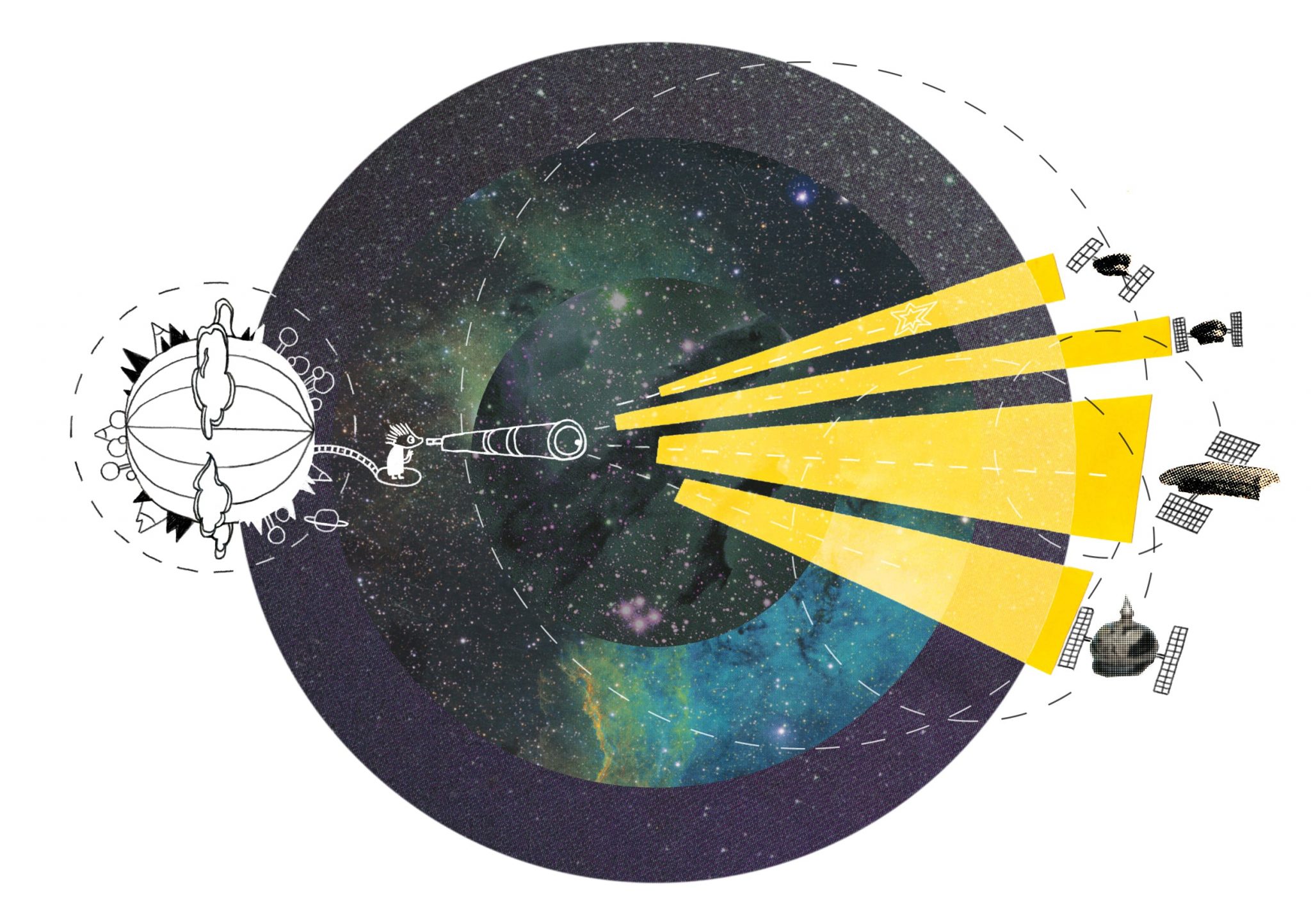Illustration: Lisa Frühbeis
Forscher befinden sich häufig in einem Konflikt zwischen Wissensdrang und ethischen Grenzen. In
einer Serie widmen wir uns deswegen umstrittenen Forschungsprojekten an den Berliner
Universitäten. Diesmal: Satelliten.
Berlin Olympiastadion. 800 Meter entfernt von hier und ebenso viele in die Tiefe lagern Berlins Erdgasreserven, die mit viel Druck in die Poren des unterirdischen Sandsteins gepresst werden. Druck, der auch das dort befindliche Grundwasser verdrängt. Welche Auswirkungen dieses Speicherverfahren hat, zeigen Bilder eines Erkundungssatelliten, der gerade in 300 Kilometer Höhe die Erdoberfläche scannt. Er kann Bodenabsenkungen und Deformationen im Millimeterbereich erfassen. „Seitdem es diese Deformationsanalysen mittels Satellitenbildern gibt, weiß man erst, dass sich große Städte eigentlich permanent bewegen“, berichtet Andreas Reigber, Chef der Abteilung für SAR-Technologie am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen.
SAR steht für „synthetic aperture radar“ und nutzt Mikrowellen zur Bilderzeugung. Diese liefern im Gegensatz zum sichtbaren Licht auch durch Wolken, Schnee und Regen hindurch und selbst nachts Bilder. Die Bilder und Messdaten, die solche Satelliten generieren, werden in der Meteorologie, der Umweltforschung oder auch für Spionagezwecke genutzt.
Damit die Satelliten funktionieren und immer bessere Daten in immer kürzerer Zeit zur Verfügung stellen können, bedarf es intensiver Forschung. Diese ist aufgeteilt auf zahlreiche Institute, Behörden, Hochschulen und private Firmen. Eine dieser Hochschulen ist die Technische Universität Berlin (TU). Hier beschäftigen sich gleich mehrere Fachbereiche mit satellitenbezogener Lehre und Forschung. Genutzt werden die Daten von Soziologen, die damit die Entwicklung von Städten erforschen, von Förstern, die damit ihren Waldbestand nach Alter und Baumhöhe gruppieren oder von Klimaforschern, die die arktischen Eismassen dokumentieren können, ohne auch nur einmal ihr Büro zu verlassen.
Auch die europäische Grenzschutzbehörde Frontex bedient sich der Bilder aus dem All, um Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer zu lokalisieren. Sie würden Insassen so rechzeitig zu Hilfe kommen können, erklärt Frontex. Menschenrechtsorganisationen werfen ihr dagegen vor, sie würde Anrainerstaaten wie Syrien, Libyen, die Türkei oder Ägypten über Ablegestellen informieren, sodass die Flüchtlinge die Außengrenzen der Europäischen Union (EU) erst gar nicht erreichen.
Je größer die technischen Möglichkeiten, desto wahrscheinlicher ist der Einsatz in Bereichen, die streitbar sind. Das fängt im zivilen Bereich an, wenn Erkundungssatelliten wie Worldview oder TerraSAR-X Bilder aus dem Weltall mit einer gigantischen Auflösung machen und setzt sich fort, wo Forscher an effizienteren Sensoren, besserer Software und ausgeklügelteren Algorithmen arbeiten, die Überwachung durch private, staatliche und supranationale Organisationen möglich machen. Im Bereich der Grenzsicherung verschwimmen mithin zivile, sicherheitsrelevante und militärische Ziele.
Stéphane Guillaso ist Forscher am Institut für Remote Sensing (deutsch: Fernerkundung) an der TU Berlin. Er betont, dass die universitären Möglichkeiten für militärrelevante Forschung begrenzt seien, allein schon wegen der limitierten technischen und finanziellen Mittel. Für konkrete militärische Forschung habe das Militär eigene Einrichtungen, die viel zielorientierter arbeiteten. Auch Andreas Reigber vom DLR ist sich darüber im Klaren, dass man ein Interesse des Militärs für seine Forschungsergebnisse nicht ausschließen kann: „Letztlich gibt es keine klare Grenze. Wenn ich Algorithmen für Umweltmodelle entwickle, kann das eventuell auch irgendwie militärisch genutzt werden. Es ist eine Grauzone, aber solange der Auftraggeber nicht aus dem militärischen Bereich kommt und die Anwendung klar definiert ist, ergibt sich da auch kein Problem.“ Beide Wissenschaftler betonen, dass insbesondere an den Universitäten der Fokus auf der zivilen Nutzung liege und man an der TU an die Zivilklausel, die Forschung für militärische Zwecke verbietet, gebunden sei.
Auch an der Universität Bremen gibt es eine Zivilklausel. Trotzdem hat sie in den Jahren 2003 bis 2006 zusammen mit dem Bremer Satellitenbauer OHB im Auftrag des Bundesministeriums für Verteidigung im Bereich der Datenübermittlung für die Luftaufklärung geforscht. Dass eine solche Kooperation nicht in Ordnung war, musste dann auch der Bremer Hochschuldirektor zugeben – jedoch erst Jahre nach dem Abschluss des Projekts.
Dass Diskussionen über Forschungsprojekte oft erst dann geführt werden, wenn sie bereits beschlossen, wenn nicht sogar abgeschlossen sind, macht die Skepsis von Außenstehenden verständlich. Daher verwundert es auch nicht, dass der Studierendenausschuss (AStA) der TU Berlin etwas genauer hinsah, als die Hochschule ein Projekt im Zusammenhang mit dem Satellitensystem Galileo startete. Galileo ist ein Verbund aus 30 Navigationssatelliten, die bis 2019 im Auftrag der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA und der EU ins All geschickt werden.
In einem Blogeintrag von 2012 schreibt der AStA, dass die Universität im Auftrag der Firma Galileo Industries an einem „test bed“ im Zusammenhang mit dem Satellitennavigationssystem forschte. Ein solches Galileo-Projekt gab es tatsächlich an der TU. Was sich hinter dem Begriff „test bed“ verbirgt und ob es tatsächlich einen entsprechenden Auftrag gegeben hat, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Die Pressestelle der Technischen Universität gibt an, dass keines der TU-Institute an der Entwicklung von Galileo beteiligt gewesen sei. Zu dem Projekt könne sie aus heutiger Sicht nichts mehr sagen.
Das EU-Parlament hat bereits im Jahr 2008 mehrheitlich für eine militärische Nutzung von Galileo abgestimmt. Ziel ist es, mit Galileo unabhängig vom US-amerikanischen GPS-System zu werden. Das stützt auch die Aussage Reinhard Bütikofers, dem verteidigungspolitischen Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament: „Anders als lange behauptet, soll die militärische Nutzung im Zentrum stehen. […] Aus einem sehr teuren Projekt, das zivil, etwa für Landwirtschaft und Lebensrettung, verwendet werden sollte, wurde unter der Hand ein noch kostspieligeres Unterfangen, dessen Dienst zu über 50 Prozent von den Armeen der Mitgliedstaaten benutzt werden soll.“ Dennoch bewirbt die EU Galileo weiterhin als ziviles Projekt.
Angesichts dieser Aussagen mag man die Besorgnis des AStA verstehen. Denn auch wenn das „test bed“-Projekt der TU Berlin am Ende nicht der Entwicklung des Galileo-System gedient haben sollte, bleibt die Ungewissheit und das Gefühl, getäuscht zu werden. Die Vorzüge der Satellitentechnologien für zivile Zwecke liegen auf der Hand. Woran es noch mangelt, ist ein ständiger Diskurs über Forschungs- und Einsatzmöglichkeiten. Denn das schafft auch die Grundlage für eine größere Akzeptanz der militärischen Verwendungsmöglichkeiten von Satellitenforschung – oder die Freiheit, diese begründet abzulehnen.
Dieser Artikel stammt aus der aktuellen UnAufgefordert (Nr. 115, Januar 2015).