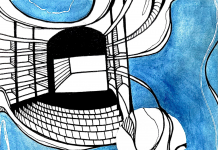Wir möchten ihn alle finden – den perfekten Job, der unserer Arbeit einen Sinn gibt und unsere Rechnungen bezahlt. Der Weg dorthin, mitten durch den Großstadtdschungel, vorbei an gesellschaftlichen Erwartungen, offenbart die inhaltliche Leere hinter dem „Traumberuf“.
Es geht schon früh um die Frage danach, was wir mal werden wollen, denn bereits in der Grundschule werden wir dazu aufgefordert, neugierigen Erwachsenen mitzuteilen, welchen Beruf wir im späteren Leben einmal ausüben möchten. Unsere Kinderköpfe finden das wundervoll, wir werden ermutigt, zu träumen. Im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen einzig und allein unsere Wünsche für eine diffuse Zukunft einer erwachseneren Version von uns selbst. Sie scheint in weiter Ferne, nicht greifbar und flüchtig wie ein Traum. Dementsprechend antworten wir mit Berufen wie beispielsweise Astronaut*in, Pirat*in oder Prinzessin, anstatt „realistische” Berufe zu nennen. Unsere Vorstellungen sind geprägt von fiktionalen Erzählungen, die komplexe Tatsachen mit Wunschdenken verhüllen.
Erwartungen verdrängen unsere Träumereien
Jahre später, angekommen in der Lebensrealität unseres erwachsenen Selbst, bekommen wir dieselbe Frage vermutlich noch häufiger gestellt. Allerdings diesmal mit Nachdruck, echten Erwartungen, latenten oder expliziten Bewertungen unserer Antworten und hierarchisch kategorisierten Berufsschubladen. Der Maßstab, nach dem sie gefüllt werden, orientiert sich primär an dem Maß an sozialem Status, materiellem Wohlstand und Sicherheit, das der jeweilige Job mit sich bringt. Selbst wenn der Traumberuf erlangt wird, ist er nicht in allen gesellschaftlichen Kreisen gerne gesehen, und sich mitzuteilen bringt oftmals keine Ruhe vor drängenden Fragen Außenstehender.
Beruf wie in Berufung
Gesellschaftlicher Druck ist immer eng mit Druck verknüpft, den wir daraus resultierend selbst auf uns ausüben – und der manifestiert sich im zweiten Teil des Wortes. Ein fester Job sichert idealerweise nicht nur die finanzielle Lebensgrundlage, sondern bildet gleichzeitig die eigene Berufung ab. Hier entsteht ein faszinierendes Spannungsverhältnis zwischen Vorstellung und Realität: Die Idee, das eigene Hobby zum Beruf zu machen, klingt zunächst traumhaft. Die meisten Menschen können es sich jedoch nicht leisten, nur zu arbeiten, wenn und weil es sie glücklich macht. Es ist ein Privileg, dieses Spannungsverhältnis aufzulösen.
Abgesehen davon ist vor allem die Perspektive junger Menschen von einem weiteren Paradoxon geprägt: scheinbar endlose Handlungsmöglichkeiten und somit vermeintlich vollkommene Entscheidungsfreiheit. Gerade in einer Kulturmetropole wie Berlin scheinen die Optionen an Studiengängen, Hobbys und Kollektiven überwältigend unendlich – eigentlich perfekt, um allen persönlichen Interessen nachzugehen. Einerseits ist diese Bandbreite an Möglichkeiten ermutigend, andererseits kann sie Vielfalt überfordert.
Berufung impliziert, möglichst früh einen ausgearbeiteten Lebensentwurf parat zu haben, der auf einer einzigen, erfüllenden Leidenschaft beruht. Noch romantischer wird diese Vorstellung, wenn sie dann auch noch deckungsgleich mit dem ist, was man schon als Kind gerne gemacht hat. Wie einfach wäre es, in eine himmlische Berufung hineingeboren zu werden, die uns magisch durchs Leben führt? Vereinzelt trifft das sicher auf Menschen zu, aber diesen Weg als Idealbild in das bedeutungsschwere Wort Traumberuf zu zwängen, verstärkt meiner Meinung nach lediglich den Druck, möglichst jung möglichst viel erreicht zu haben. Es füttert das Ideal einer überambitionierten Studentin, deren unbezahlte Praktika für die nächsten Sommer bereits fest in ihrem Fünfjahresplan verankert sind, den sie stolz bei jedem Bewerbungsgespräch vorlegen kann. Das Konstrukt Traumberuf entpuppt sich in dieser Hinsicht nicht als eine Befreiung, sondern eine Zwangsjacke, die durch gesellschaftliche Konventionen gefüttert wird.
Traumberuf dekonstruiert
Niemand muss mit Anfang oder Mitte zwanzig einen Traumberuf, geschweige denn eine Lebensberufung gefunden haben oder aktiv suchen. Vor allem dann nicht, wenn dessen Existenz vielleicht nichts als ein Konstrukt internalisierter Produktivitätsansprüche ist. Stattdessen sollten wir uns die Freiheit einräumen, in verschiedene Richtungen zu träumen, ein gesundes Maß an kindlicher Neugier beibehalten und dadurch Raum für neue und alte Interessen lassen. Ein erster Schritt, um diesen Druck aufzulösen, könnte darin liegen, den Mitmenschen die Genugtuung einer klaren Antwort zu verweigern und sie stattdessen im Gespräch mit Freund*innen zu suchen.
Illustration: Lotte Marie Koterewa