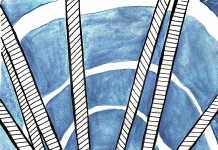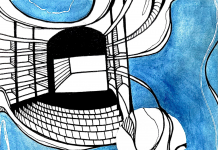Viele Autistinnen werden erst spät in ihrem Leben diagnostiziert. Jahrzehntelange Unwissenheit kann zu psychischen Problemen wie Depressionen oder Burnout führen. Zwei studierende, spät-diagnostizierte Autistinnen berichten.
Autistische Frauen erfahren im Alltag konstant Ausgrenzung aufgrund von Forschungslücken. Wie in vielen anderen medizinischen Feldern wurden Frauen in der Autismus-Forschung lange Zeit nicht mitberücksichtigt. Zudem äußern sich die Symptome bei autistischen Frauen anders als bei autistischen Männern. Eine Psychologin der Spezialambulanz für Soziale Interaktionen der HU Berlin, die dort Diagnostik für erwachsene Menschen anbietet, erklärt: „Bei Mädchen treten oft Spezialinteressen auf, die als stereotypisch weiblich gelten, wie Pferde oder Mode. Deshalb fällt es nicht auf, wenn sie ein über die Maße ausgeprägtes Interesse dafür entwickeln und beispielsweise Pferderassen katalogisieren, obwohl sie selbst gar nicht reiten.“ Des Weiteren werde Schüchternheit bei Mädchen oft als „normales“, sozial angepasstes und erneut genderkonformes Verhalten interpretiert. Autistische Mädchen seien jedoch nicht einfach schüchtern; sie wissen nicht, wie sie sich in der sozialen Interaktion verhalten sollen.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass eine Studie des australischen Kinderarztes Dr. Robert McCrossin von 2022 die Zahl der undiagnostizierten weiblichen Autistinnen bei Beginn der Volljährigkeit auf 80 Prozent aller betroffener Frauen schätzt.
Hürden im Studium
Eine dieser spät-diagnostizierten Autistinnen ist die 25-jährige Sophie. Sie wurde vor einem halben Jahr mit der Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert. Vermutet hatte sie dies zwar schon mit 16; allerdings habe sie sich erst viel später eingehend mit dem Thema beschäftigt und einen Termin für die Diagnostik vereinbart.
Abgesehen davon, dass auch sie Schwierigkeiten mit sozialer Interaktion hat und es ihr deswegen schwerfällt, Freundschaften zu schließen, muss sie sich auf alles sehr gut vorbereiten: „Wenn ich auf etwas nicht vorbereitet bin, dann mache ich es nicht. Früher führte das zu Problemen in der Schule, weil ich dann einfach nicht hingegangen bin.“
Auch auf ihr Studium wirkt sich dieses Bedürfnis, alles unter Kontrolle zu haben, aus. Sophie studiert Chinesisch und Informatik auf Lehramt in Berlin. Aufgrund des Autismus hatte sie bereits viele Fehlzeiten. So hat sie etwa direkt im ersten Semester zwei Wochen am Stück gefehlt und seit drei Semestern kann sie gar nicht mehr an den Kursen teilnehmen. Dadurch wird sich ihr Studium verlängern. Zwar gebe es einen Nachteilsausgleich, den Sophie theoretisch in Anspruch nehmen könnte, sowie eine explizite Ansprechstelle für mentale Gesundheit von ihrer Studienfachrichtung, allerdings fällt ihr auch solch eine Kontaktaufnahme schwer: „Ich habe mir das schon seit einem Monat vorgenommen, es aber bislang noch nicht geschafft. Tatsächlich wurde für die Beratungsstelle aber auch auf Instagram geworben, was hilfreich war, da man so schon einmal ein paar Gesichter gesehen hat.“
Vom Verdacht zur Diagnose
Auch die 21-jährige Fiona* hat bereits im Jugendalter eine Neurodivergenz bei sich vermutet. Das Gehirn von neurodivergenten Menschen funktioniert anders als das von neurotypischen Menschen. Das heißt, dass sie etwa Gefühle und äußere Reize anders wahrnehmen, als es in der Norm-Gesellschaft erwartet wird.
Fiona hatte Panikattacken während der Schulzeit, die sich später als autistische Meltdowns herausstellten. In der Oberstufenzeit litten ihre Noten plötzlich darunter. Als Grund vermutete Fiona ADHS. Zu Beginn ihres Lehramtsstudiums setzte sie sich intensiver damit auseinander und suchte sich Hilfe bei einer Psychiaterin, die ihr wiederum einen auf ADHS und Autismus spezialisierten psychologischen Psychotherapeuten empfahl. Von ihr wurde sie letztendlich sowohl mit ADHS als auch mit Autismus diagnostiziert. Als Fiona die Autismus-Diagnose erhielt, war sie 20.
Dass sie erst so spät diagnostiziert wurde, kann sich Fiona so erklären: „Ich bin sehr isoliert aufgewachsen, teilweise auch mit Gewalt. Mein Vater hat außerdem den ganzen Tag gearbeitet. Da wurde nicht auf die mentale Gesundheit geachtet. Und in der Schule werden Mädchen leider oft als schüchtern eingeschätzt. Es wurde also angenommen, dass ich einfach schüchtern bin und vielleicht ein bisschen Angst habe.“
Fiona verknüpft ihre späte Diagnose aber auch mit Diskriminierungserfahrungen, die sie aufgrund ihres Migrationshintergrundes in der Schule machen musste. Sie sagt, sie könne sich gut vorstellen, dass die Lehrer*innen sie als nicht integriert abgestempelt haben, ohne weiter zu hinterfragen: „Gerade Frauen mit ausländischen Wurzeln haben es oft sehr schwer, im medizinischen Bereich ernstgenommen zu werden.“
Eine Diagnose kann Erleichterung verschaffen
Laut der Diagnostikerin der Spezialambulanz für Soziale Interaktionen sei es wichtig, mit dem Autismus zu arbeiten und nicht ihn zu heilen, denn das könne man nicht: „Es geht darum, zu erkennen, was meinen Bedürfnissen entspricht. Wie kann ich mir meine Räume schaffen? Wie kann ich mich im Alltag strukturieren, damit ich gut zurechtkomme? Können mir beispielsweise Noise-Cancelling-Kopfhörer helfen? Kann es mir helfen, Seminare online wahrzunehmen? Ist Gruppenarbeit schwierig für mich?“
Wenn das nicht geschieht, kann es so aussehen wie bei Sophie und Fiona: totaler Rückzug und Erschöpfung bis hin zum Burnout. Auch Fiona schafft es nicht mehr, sich an Deadlines zu halten, und wenn, dann setzt sie sich erst kurz vor Schluss ran. Ihre Leistungen haben nachgelassen. Auch sozial habe sie sich vollkommen isoliert, erzählt die Studentin. Eine Hausarbeit schiebe sie bereits seit einem Jahr auf.
Eine offizielle Diagnose, selbst wenn diese erst spät kommt, kann vielen Betroffenen helfen. Für Fiona war es wichtig, erkennen zu können, in welchen Situationen sie überfordert ist, um einen eventuellen Meltdown oder Shutdown – also nach außen beziehungsweise nach innen gerichtete Reaktionen auf eine Reizüberflutung – zu verhindern. Wenn sie das frühzeitig merkt, kann sie sich zurückziehen und warten, bis es vorbei ist. Des Weiteren sei es einfach schön, zu wissen, dass es nicht an ihr liege, dass sie Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen habe. Sophie beschreibt ähnliche Erfahrungen: „Vor der Diagnose habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum ich Sachen nicht auf die Reihe bekomme und mit vielen Dingen Schwierigkeiten habe. Jetzt weiß ich, dass nichts falsch mit mir ist.“
Die Diagnostikerin der HU berichtet zudem, dass bei einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung wie Autismus in einigen Aspekten anders vorzugehen sei als bei einer Zwangsstörung oder einer sozialen Angst und es insofern relevant sei, eine genaue Diagnose stellen zu können. Fiona findet, trotz aller Hürden, die ihr der Autismus bislang bereitet hat, auch Positives an ihm. So hat sie etwa schon immer sehr viele philosophische Gedanken gehabt, die sie als bereichernd beschreibt: „Ich habe nie wirklich verstanden, was Leben ist. Ich habe alles hinterfragt und wollte alles wissen und konnte nicht eher aufhören, bis ich eine Antwort gefunden habe. Diese Wissbegierde hilft mir auch an der Uni.“
*Name von der Redaktion geändert.
Illustration: Franziska Auffenberg