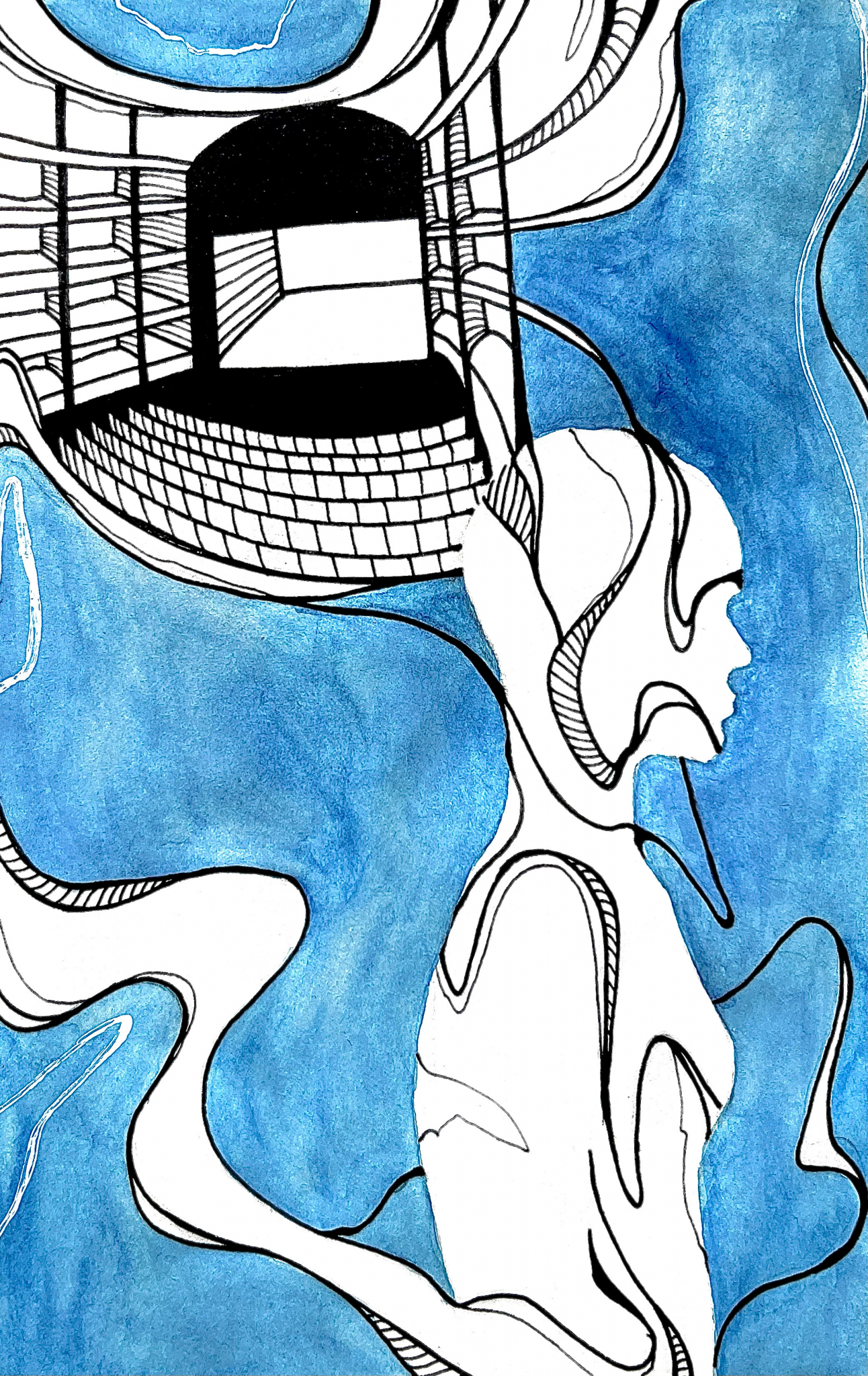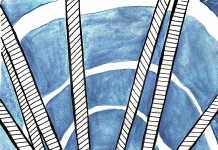Wie sieht der Traum vom Arbeiten am Theater aus? Welche Versprechen werden eingelöst und wann müssen diese einer harten Realität weichen? „Stress wird häufig glorifiziert. Je gestresster ich bin, desto gefragter bin ich oder desto erfolgreicher bin ich. Dann gilt es als edgy, ein bisschen fertig zu sein, aber das wiegt dem nicht auf.“ Patricia Stövesand, Regieassistentin am SchauSpielHaus Hamburg, zum Thema Arbeiten unter Druck.
Um 7 Uhr klingelt der erste Wecker. Patricia drückt auf den Snooze-Button ihres Handys. Drei oder vier Mal. Spätestens um 7:30 muss sie aufgestanden sein. Das Handy checkt sie schon nach dem ersten Augenaufschlag. Sie scannt, welche Nachrichten in welcher Reihenfolge abgearbeitet werden müssen. Nach dem Aufstehen geht es daran, den zweiten Schwung an Mails und SMS zu beantworten. Für’s Frühstück oder Duschen ist meist keine Zeit mehr.
Um 8:30 betritt Patricia das Theater. Sie bereitet die Probe vor und druckt Fassungen für das Ensemble. Gegen 9 Uhr sammelt sich das Regieteam für dispositorische Angelegenheiten – zeitgleich werden wieder Mails und Nachrichten auf dem Handy beantwortet. Um 10 Uhr beginnt die Probe.
Kein Ort für mich
„Das Schlimmste ist, dass es keinen Zeitpunkt und keinen Ort gibt, den ich nur für mich habe. Ich bin immer verfügbar. Es gibt keine Müdigkeit. Man kann es sich nicht leisten, unaufmerksam zu sein oder Dinge hinten anzustellen“, erzählt Patricia zu den Herausforderungen dieses Arbeitsalltages. Dazu gehört vor allem der Druck, immer und überall erreichbar zu sein. Das Handy bleibt an – auch Zuhause und nach dem Ende der offiziellen Arbeitszeit. Der Blick auf den Bildschirm, das Reagieren auf ein Ton-Signal strukturieren den Tag.
Um 14:30 startet die Pause für das Team. Während die Schauspieler*innen Zeit haben, um sich kurz auszuruhen oder in die Kantine zu gehen, heißt das für Patricia, Telefonate zu führen und Nachrichten der Teammitglieder oder aus dem Haus zu beantworten: „Wenn es richtig gut läuft, dann trinke ich einen Kaffee von der Bäckerei gegenüber vom Theater. Dafüt habe ich eigentlich keine Zeit, aber manchmal ergibt es sich dann doch.“
Um 16 Uhr findet die Beleuchtungsprobe statt. Die kann zwischen drei und vier Stunden dauern. Währenddessen muss Patricia die weiteren Probentage organisieren, nimmt an Meetings und Jours-Fixes teil. Diese Form der Doppelbelastung ist nicht ungewöhnlich. Häufig werden von Regieassistent*innen mehrere Jobs gleichzeitig durchgeführt oder ihre Verfügbarkeiten doppelt belegt.
Zu Konflikten kommt es dann, wenn Aufgaben nicht richtig verteilt oder besprochen wurden: „Wir müssen Zuständigkeiten klären. Für alle Berufsgruppen müsste transparent kommuniziert werden, wer für was zuständig ist und wer wann erreichbar ist. Dazu kommt, dass sich niemand auf Machtpositionen ausruhen darf. Aufgaben, die absichtlich abdelegiert werden, erhöhen den Druck für alle anderen im Team. Wichtig wäre überhaupt eine festgelegte Pausenzeit. Die müsste unverhandelbar sein und vor allem eingehalten werden. Im Normalvertrag (NV) Bühne ist eine solche Ruhezeit auch festgelegt, aber kann nach Belieben interpretiert werden, sodass dann häufig doch keine Pausenzeit eingehalten werden kann.“
Um 18 Uhr startet die Abendprobe. Patricia flucht. Auf dem Weg zur Probe hört sie „Bolero“ von Maurice Ravel oder Techno. Die Kopfhörer bleiben im Ohr bis sie an der Bühne angekommen ist. Viele Regisseur*innen arbeiten nach dem Prinzip der geteilten Probe. Das bedeutet eine offizielle Arbeitszeit von 10-14 Uhr und von 18-22 Uhr. Doch für die Regieassistent*innen ist das nur eine Utopie. „Wenn der zweite Probenblock, bei dem wir häufig einen szenischen Durchlauf machen, um 22 Uhr fertig ist, spreche ich wieder mit dem Regieteam, bespreche Korrekturen, frage bei den Gewerken nach Kritik und tausche mich aus. Solche Kritikrunden sind offiziell begrenzt, aber gehen fast immer länger.“
Unter Druck arbeiten
Die konstante Verfügbarkeit und der kräftezehrende Tagesrhythmus führen zu starken Einschränkungen des Privatlebens und körperlicher Erschöpfung: „Man kann es sich nicht leisten, unaufmerksam zu sein oder Dinge hinten anzustellen. Ich kann nichts auf andere Tage legen. Gerade in den Endproben muss alles direkt geklärt werden.“
Unter Druck zu arbeiten, bedeutet für Patricia vor allem Stress, der aber auch manchmal produktiv sein kann: „In Projekten hat man das Privileg, sich voll und ganz einer Sache widmen zu können. Ohne Pausen sorgt das aber dafür, dass ich auf eine Art müde werde, ich sage dazu, dass ich auch mit einer Woche ausschlafen nicht mehr richtig fit werde. Je mehr ich unter Druck stehe, desto weniger kreativ kann ich sein. Ich lese weniger, schreibe weniger und habe keine Energie, mich mit anderen Menschen auszutauschen. Ich funktioniere so nicht als Freundin, Partnerin oder Elternteil.“ Mut in solchen Phasen können vor allem gute Freund*innen machen. Maria-Christina Piwowarski, Leiterin der Buchhandlung Ocelot in Berlin, ist so ein Mensch für Patricia. Sie erinnert sie immer wieder daran, dass Theater nicht das ganze Leben ist und unterstützt sie gleichsam in ihrer künstlerischen Arbeit und Entwicklung.
Funktioniert das Theater also nur unter Druck? Kann der Betrieb weiterlaufen, wenn Mitarbeiter*innen dieser Arbeitsform entsagen? „Das ist ambivalent: Der Betrieb läuft immer weiter und man bekommt alles immer irgendwie hin. Egal wie wenig Kapazitäten vorhanden sind. Der Erfolg, der dahinter steckt, lastet dann aber auf den Schultern der Menschen. Es gibt zu wenig Häuser, die mit der Haltung, die man an Kolleg*innen stellt, scheitern. Es gibt nicht zu wenig Menschen, die sich hier für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, aber die Wege, die es dazu an den großen Schauspielhäusern zu gehen gibt, sind schwierig. Da kommt es darauf an: Wer sitzt dort in Führungsetagen? Wie stark oder flach ist die Hierarchie? Die Menschen werden häufig beschmunzelt oder gelten als arbeitsscheu oder zu sanft, um den Job aushalten zu können.“ Das sei eher keine Frage der Befindlichkeit, sondern des Systems.
Nach der Arbeit
Gegen 24 Uhr: Zuhause schreibt Patricia ihre To-Dos für den nächsten Tag auf, beantwortet Nachrichten und schickt eine Probenerinnerung an die Teammitglieder raus. Dann fällt sie ins Bett. Das ist ungefähr gegen 1 Uhr: „Nach anstrengenden Endproben gucke ich abends den Tatort Münster – Mord ist die beste Medizin. Manchmal schaue ich den auch viermal die Woche. Oder ich meditiere.“
Aber lohnt sich das alles? Können die Erfolgserlebnisse und Bestätigungen der kreativen Arbeit der Frustration und Müdigkeit aufwiegen? Und wie lange lässt sich das aufrechterhalten? Auf die Frage nach den Perspektiven, die dieser Stress für sie bietet, bleibt Patricia ambivalent: „Das changiert zwischen dem großen Privileg, überhaupt Kunst machen zu können und gleichzeitiger Frustration. Und einem gewissen Maß an Traurigkeit. Man schüttelt mit dem Kopf und fragt sich, warum man sich durch diese harten, unfairen und prekären Arbeitsbedingungen schleppt. Es ist hart, sich immer wieder zu fragen, ob das, was man bekommt, Entschädigung genug ist für das, was man gibt.“
Aktuell betreut Patricia die Produktion “Morgenstern” am Deutschen SchauSpielHaus in Hamburg unter der Regie von Victor Bodo.
Illustration: Lotte Marie Koterewa