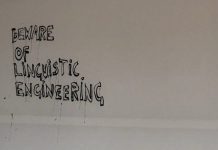Im Foyer vor dem Senatssaal der Humboldt-Universität finden sich neue Gesichter. Die Nobelpreisträger in ihren ehrwürdigen Posen und in ihren großen, rechteckigen Rahmen wichen Philosoph*innen und Vordenker*innen, die dem heutigen Verständnis von Universität gerechter werden. Die HU gedenkt endlich jenen, die für einen akademischen Habitus einstanden, der bis heute nachwirkt und auf den die HU stolz sein sollte. Denn Humboldtianer*innen sind eben nicht nur alt, weiß und männlich.
Zu Beginn des Presserundgangs in der Ahnengalerie der Humboldt-Universität fällt oft das Wort „Diversität“ und noch öfter ist die Rede vom Selbstbekenntnis, nicht mehr „alt, weiß und männlich“ zu sein. Dieses Buzzwording verrät vor allem eines: Die HU ist aus ihrem Dornröschenschlaf des immerwährenden Gestern aufgewacht. Gleichzeitig, so scheint es, wollen der Kommissarische Präsident Peter Frensch und die Vorsitzende der Historischen Kommission Gabriele Metzler gleich zu Beginn der Vorführung einen Bildersturm in der neuen Ahnengalerie mit der Macht ihrer Worte verhindern. Angst darum müssen sie nicht haben, denn die neuen Gesichter der HU gehen über den bloßen Eindruck des guten Willens hinaus.
Vorbei ist die Zeit, in der Studierende, Lehrende und Gäst*innen den großen Theodor Mommsen, seines Zeichens Nobelpreisträger für Literatur, anschmachten mussten. Dieser hat zwar in der jetzigen Ahnengalerie seinen Platz erhalten, jedoch sitzt er nun weitaus dezenter zwischen anderen großen Persönlichkeiten der Universität, zum Beispiel direkt neben Rahel Hirsch, die als erste Frau eine Professur in Medizin erlangte. Seine gewichtige Pose vor einem aufgeschlagenen Buch ist entschärft worden, genauso wie das Abbild des Nobelpreisträgers Otto Hahn, der auf einem Foto nun neben der ersten promovierten Physikern Lise Meitner posiert.
Und auch der Soziologe und Bürgerrechtler W.E.B. Du Bois hat seinen Platz erhalten. Dieser war zwar „nur“ für eine kurze Zeit an der Humboldt-Universität immatrikuliert. Die Zeit im damaligen Deutschen Reich und an der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, der heutigen HU, hatten den ersten Schwarzen Soziologen geprägt.
Das Mammutprojekt einer Neuinterpretation hat sich anscheinend gelohnt, denn seit den ersten Gedanken über eine Reformierung der Ahnengalerie bis zur aktuell gezeigten Ausstellung sind ganze acht Jahre vergangen, aber dazu später mehr.
Nobelpreise allein machen keine echten Humboldtianer*innen
Das Thema mit den „herausragenden Wissenschaftler*innen“ ist allen voran ein zweischneidiges Schwert, mit dem sich die HU auch ein neues Image zulegen möchte. Weg vom einstigen Gelehrtentempel vorangegangener Jahrhunderte hinüber zur Universität des 21 Jahrhunderts heißt die Devise. Der Nobelpreis allein wird dem akademischen Leben der HU nicht mehr gerecht und das ist vermutlich der wichtigste Punkt, den das Kuratorium zeigen wollte. Die Universität erneuert das traditionelle Gedenken der akademischen Leistung, die bis dato bekanntlich nur aus dem Gehirnschmalz einiger weniger privilegierter Männer bestand. Die Biografien einst unantastbarer Wissenschaftler werden offen hinterfragt und teils auch kritisiert. Das Kapital der Humboldt – und das ist der entscheidende Punkt – soll nach dem Willen der Kurator*innen die stets betonte Exzellenz neu definieren.
Und so gehe das Grundkonzept der neuen Ahnengalerie laut Frensch auf zwei grundlegende Entwicklungen der vergangenen Jahre zurück. Im Zuge der anhaltenden Diskurse über Diversität und dem Aufbrechen postkolonialer oder patriarchaler Strukturen gerieten auch die Individuen der Universitätsgeschichte in den Fokus. „Die Geschichte dieser Universität kann nicht die Geschichte weniger, alter weißer Männer sein“, erklärt der kommissarische Präsident mit Blick auf die einstige Ahnengalerie.
Die größte Frage dabei stellt Frau Metzler selbst an ihre Arbeit als Vorsitzende der Historischen Kommission: „Können Nobelpreisträger eine Universität des 21. Jahrhunderts allein repräsentieren?“ Universität im 21. Jahrhundert bedeute auch das Anerkennen anderer Leistungen als nur dem Nobelpreis, der ja nachweislich nur an männliche Professoren der HU gegangen ist, so Metzler.

Mit der neuen Sammlung wolle die historische Kommission eine „Monokultur“ innerhalb des universitären Gedenkens verhindern. Und dennoch: „Der allererste Zugriff müsse es sein, exzellente Wissenschaft zu zeigen“, so Metzler. Dabei müsse die Universität aber auch ihrer Pflicht nachkommen, etwa indem sie in die Gesellschaft hineinwirke. Eine „Transferleistung“ stelle demnach auch die Präsentation von Zivilcourage, Engagement oder einer ungewöhnlichen Biografie da. Ungewöhnlich war es zum Beispiel noch vor hundert Jahren, dass Frauen überhaupt promoviere durften; gelinde gesagt war es beinahe unmöglich. „Die ersten, die immer übersehen wurden, waren Frauen“, so Metzler. Diese sollen nun nicht mehr alibihaft in den Fluren hängen. Damit will die Historische Kommission nach jahrelangen Überlegungen die Frauen aus der Unsichtbarkeit herausholen und als integralen Bestandteil der Erinnerungskultur nutzen.
Vor zwei Jahren begann sich daher die historische Kommission mit dem Wandel der Ahnengalerie aktiv auseinanderzusetzen – etwa sechs Jahre nachdem es zum allerersten Mal zu einem regelrechten Eklat in Foyer des Hauptgebäudes gekommen war. Denn bereits 2014 zeigte sich, dass im Sinne des Gedenkens Nachholbedarf herrschte. Damals machte eine Gruppe mit dem Namen „Wissen im Widerstand“ auf sich aufmerksam, als sie am rechten Treppenaufgang das Portrait des Nobelpreisträgers Adolf Butenandt „entführte“. Besagter Wissenschaftler erhielt 1939 den Nobelpreis für Chemie. Außerdem war er dafür bekannt, im Dritte Reich rassistische Forschung betrieben zu haben. Nach 1945 arbeitete er weiterhin daran, seine NSDAP-Mitgliedschaft zu verschleiern und zu verharmlosen.
Am Ende bleibt das „Jahrhundert der Extreme“
Im Westflügel hängen dann aber auch Größen wie Robert Havemann, der als Chemiker den Kurator*innen nach exzellenter Forschung betrieben hatte und als überzeugter Kommunist gegen die Nazis im Widerstand war. In seinen jungen Jahren war er aber auch bekennender Stalinist, später dann wurde er als Regime-Kritiker von der DDR-Führung unter Hausarrest gestellt.
Und so erfüllt die neue Ahnengalerie auch einen weiteren Zweck. Sie öffnet den Diskurs mit Hilfe widersprüchlicher Biografien, um auf die Schwierigkeiten einer Erinnerungskultur hinzuweisen. Lebensläufe wie der Havelmanns spiegeln laut Metzler nicht zuletzt das „Jahrhundert der Extreme“ wider, in dem die meisten der ausgestellten Wissenschaftler*innen und Studierenden wirkten.
Und auch Erwin Schrödinger ist in der neuen Ahnengalerie vertreten, selbst wenn ein dunkles Kapitel seiner Biografie bis heute nachhallt. Es ist kein Geheimnis mehr, dass sich der Mitbegründer der Quantenphysik gegenüber jungen Frauen und Mädchen übergriffig und missbräuchlich verhielt. Auch ist es kein Geheimnis mehr, dass das nach ihm benannte Erwin Schrödinger-Zentrum in Adlershof einen neuen Namen vertragen könnte. Man könnte bereits jetzt Wetten darüber abschließen, wann er aus der Ahnengalerie „entführt“ wird.
Acht Jahre hadern mit der Erinnerungskultur
Die Kommission hatte sich bereits 2014 gegründet, um genau über solche „übergeordneten Dinge“ im Rahmen des Gedenkens zu diskutieren. Wie Frau Metzler erklärt, stellt sich für die HU bis heute die Frage, welche Form der Erinnerungskultur angebracht wäre. Die Entführung Butenandts hatte seine Wirkung nicht verfehlt. „Das hier ist der Anfang“, sagt die Vorsitzende der Historischen Kommission mit Blick in die Ahnengalerie, denn die Seitenflügel sollen in absehbarer Zeit ebenfalls Gesichter der Universität bekommen.
Doch bis die gesamte Galerie steht, werde es noch ein wenig dauern. So wissen die Initiator*innen der Historischen Kommission nicht genau, wann zum Beispiel der Ostflügel des Hauptgebäudes fertiggestellt würde. Der bleibt anscheinend auf unbestimmte Zeit eine Baustelle. Laut Gabriele Metzler könnte jedoch der Westflügel neben dem Senatssaal bereits Ende 2022 eine weitere Sammlung an Ahnen beherbergen. Am Ende des Ganges soll darüber hinaus Platz für wechselnde Ausstellungen entstehen.
Alles schön und gut, doch sind seit der Entführung des Bildes von Adolf Butenandt fast acht Jahre vergangen. Eine solche Dauer wirft viele Fragen auf, zumal in dieser Zeit Debatten über postkolonialistische Strukturen, verdeckten Rassismus und #MeToo überall verhandelt wurden. Nur das Foyer der HU schien, wie in einer Zeitkapsel verhüllt zu sein und dabei nicht mal Staub anzusetzen.
Wie Gabriele Metzler sagt, habe noch der ehemalige HU-Präsident Jan-Hendrik Olbertz sich für ein Fortbestehen der Galerie eingesetzt. Der Gedanke dahinter leuchtet ein, schließlich ist ein Nobelpreis vermutlich der beste Beweis dafür, was exzellente Wissenschaft eigentlich auszeichnet. Wo kämen wir hin, so werden einige Befürworter*innen gedacht haben, wenn eine solche Leistung nicht anerkannt würde? Doch auch Herr Olbertz ist von diesem Gedanken abgerückt und war auch kuratorisch an der jetzigen Galerie beteiligt.
Dass die HU mit ihrem historisch gewachsenen Erbe bewusst umgehen muss, hat vermutlich auch dazu geführt, sich allzu große Sorgen um das eigene Image zu machen. Und so verbindet sich mit der neuen Ahnengalerie auch der Wunsch nach einer selbstbestimmten Erinnerungskultur.
Foto: Philipp Plum / HU