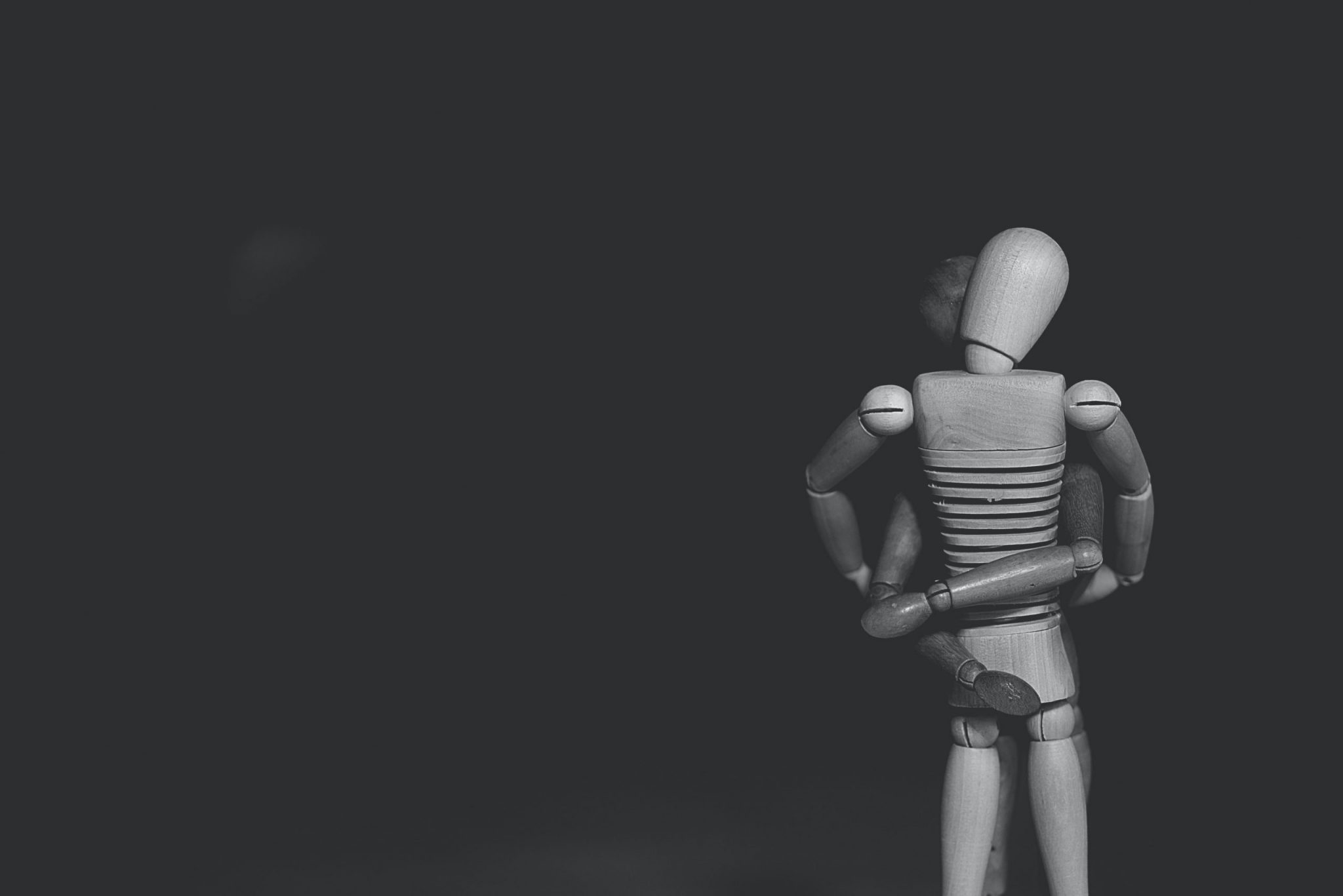Sexarbeitende leben meist schon an der Armutsgrenze und im Schatten der Gesellschaft. Im Gegensatz zu Kleinkünstler*innen und mittellosen Eltern gibt es kein spezielles Hilfsprogramm für sie.
Das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend nahm, wenn doch recht spät, wahr, dass die Beschränkungen im Kampf gegen das neue Coronavirus auch Auswirkungen auf die Lage von Sexarbeitenden haben. Maßnahmen, wie Hinweise zur Auslegung des bundesweit seit 2017 geltenden Prostitutionsschutzgesetz, sodass die Länder das Gesetz nun drehen können, wie sie Lust und Laune haben, verfehlen wie jene anderen Hilfestellungen dieser Tage ihr Ziel, da sie die prekäre Lage der Berufsgruppe umschiffen bzw. jene Sexarbeitenden erst gar nicht erreichen.
Seitdem Bordelle geschlossen sind und Sexarbeit verboten ist, bricht vielen, die laut dem Bundesverband für Sexarbeit an der Armutsgrenze leben, die finanzielle Einnahmequelle weg. Im Umkehrschluss können nicht nur Lebensmittel, sondern auch Mieten nicht mehr bezahlt werden. Nun von Obdachlosigkeit bedroht, müssen sie mit Existenzängsten umgehen, die zu verzweifelten illegalen Angeboten verführen: Trotz Verbot und steigendem Risiko der Ansteckung körperliche Nähe innerhalb der eigenen vier Wände anzubieten, wie eine Sexarbeiterin gegenüber dem Cicero berichtet. In Zeiten von „social distancing“, Kontaktsperren und Prostitutionsverbot ist die Zahl der Freier*innen jedoch überschaubar.
Bundesministerium schafft keine Klarheit
Eines sollten die Maßnahmen gemein haben, dass sie Frauen, auf deren Lebenssituation sich die Corona-Krise besonders auswirke, konkret helfen können. Doch ist der Absatz zur Lage der Sexarbeitenden nicht nur von Seiten der Berichterstattung undurchdacht zurückgeblieben. Die Maßnahmen zum Schutz von Prostituierten schaffen keinen Ausweg sondern eine Grauzone. So endet die Abhandlung mit den Worten: „Die Schließung von Prostitutionsbetrieben bedeutet nicht, dass Sexarbeitende nicht mehr in diesen übernachten dürfen.“
Warum kommt es überhaupt zur Sprache, dass Sexarbeitende in Bordellen übernachten dürfen? Nach Paragraf 8 des Prostitutionsschutzgesetz müssen Prostitutionsstätten mindestens dafür sorgen, dass die für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume nicht als Schlaf- oder Wohnraum genutzt werden. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, das Familienministerium hätte das Übernachtungsverbot in Bordellen für die Zeit der Corona-Krise ausgesetzt. Doch ist das Aussetzen des Übernachtungsverbots in der Krise den Ländern überlassen.
Lediglich eine Hintertür ließ das Bundesministerium offen, um nach der Krise wieder mit aller Härte gegen Verstöße vorzugehen. Ursprünglich wurde das Gesetz verabschiedet, um Prostituierte vor Ausbeutung zu schützen, doch gibt es bis heute keine finanzielle Unterstützung vom Staat, mit deren Hilfe sich Prostituierte eine eigene Wohnung leisten könnten. So fährt der Staat mit den Kontrollen lediglich Geld ein und sorgt dafür, dass kleinere Bordelle schließen müssen. Damit nach der Krise nicht vor der Krise ist, müssten finanzielle Anreize für ein eigenständiges Wohnen gesetzt werden, denn mit Blick ins Portemonnaie rentiert sich das illegale Wohnen im Bordell bislang ungemein.
Warum verstrickt sich die Familienministerin mit dem Statement „Die Schließung von Prostitutionsbetrieben bedeutet nicht, dass Sexarbeitende nicht mehr in diesen übernachten dürfen.“ in doppelten Verneinungen? Weil eine solche Aussage Spielraum lässt, nicht direkt auf die anscheinend bewusste Lebenswirklichkeit von Sexarbeitenden einzugehen.
Jene leben grundsätzlich in Grauzonen – ohne Mietvertrag, meist direkt im Bordell. Weil in Krisenzeiten Auslegungshinweise fürs Gesetz den Ländern anzubieten, auch nicht nicht bedeutet, dass es umgangen wird. Aber vor allem, weil sich hinter schwammigen Formulierungen zu verstecken, weniger Mühen fordert, als die eigenen Gesetze zu überdenken. Krisen machen auch vor Gesetzen nicht halt, doch sind vor allem in diesen unsicheren Zeiten klare Aussagen und spezielle Hilfestellungen nötig.
Unangemeldete Prostitution – ein Hindernis?!
Das Gesetz zum Kündigungsschutz für Mieter*innen könnte in der Not, die eigene Wohnung zu verlieren, Abhilfe schaffen, dafür müssten Sexarbeitende aber offiziell zur Miete wohnen. Rettung könnte auch mit dem Hilfepaket für Solo-Selbstständige in Sicht sein, doch über die Zugänglichkeit dessen für Sexarbeitende scheiden sich die Geister. Die Beratungsstelle für Prostitution in Trier fordert beispielsweise, dass die staatlich gemeldeten Prostituierten auch von den Corona-Hilfen des Bundes für Solo-Selbstständige profitieren sollten. Wohingegen der Berufsverband für Sexarbeit herausstellt, „dass Sexarbeitende dieselben Rechte auf finanzielle Hilfen haben, wie alle anderen Solo-Selbstständigen auch.“
Finanzielle Hilfe vom Staat ist in jedem Fall an eine Registrierung als Selbstständiger geknüpft – Sexarbeitende müssten als solche angemeldet sein, wie es das Prostitutionsschutzgesetz will. Doch ist die Realität, wie die Dunkelziffern zeigen, eine andere. Egal ob angemeldet oder nicht, für Sexarbeiter*innen gilt die Tage der ernüchternde Leitsatz: Kein Sex – kein Geld.
Das Gesetz, das seit Jahren die Spreu vom Weizen trennt, die gemeldeten von den ungemeldeten Sexarbeitenden, richtet heute über letztere. Denn obwohl Sexarbeitende vorübergehend in Bordellen übernachten dürfen, gibt es keine offizielle Erklärung, wie unangemeldete Prostituierte, ohne zu betteln, dem Hungertod entkommen sollen. Klare Worte sollten nicht Mangelware sein. Dabei muss sich das Ministerium wohl auch eingestehen, dass Hilfemaßnahmen für Menschen, die unter dem Radar leben, noch nicht gefunden sind.