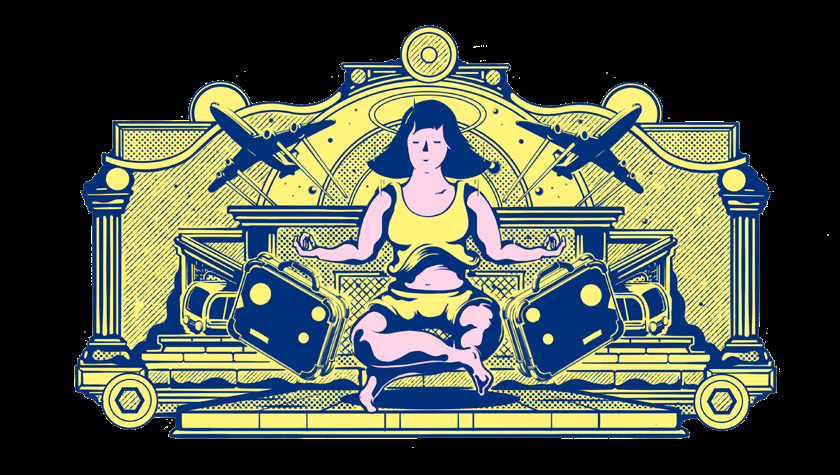Weniger Müll produzieren, nicht mehr fliegen: Eine Lösung der Klimakrise baut darauf, dass wir alle zu besseren Menschen werden. Andere Stimmen fordern eine Änderung des Systems. Kann uns das die individuelle Verantwortung nehmen?
Wenn Umweltaktivist*innen politische Forderungen formulieren, wird häufig geprüft, inwiefern sie sich selbst klimaneutral verhalten – so kritisierte die FAZ die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer für ihre Langstreckenflüge und Greta Thunberg wurde der Verzehr eines in Plastik verpackten Toastbrots vorgeworfen. Bei kaum einem anderen politischen Thema wird das korrekte Verhalten derjenigen, die Forderungen an die Politik stellen, so umgehend geprüft.
Christoph Rehmann-Sutter, Professor für Bioethik an der Universität Lübeck, erklärt diesen Umstand mit der Besonderheit der Klima- und Umweltproblematik: „Wir machen uns fast alle mehr oder weniger mitschuldig, notgedrungen und ohne es vermeiden zu können“. Heißt: Wir alle sind durch unser alltägliches Verhalten, unsere Konsum- und Verbrauchentscheidungen Teil des Problems. Es gibt vermutlich derzeit kein anderes politisches Thema, bei dem individuelles Verhalten und politische Problemlösung so eng miteinander verknüpft sind.
Zwar liegt es nahe zu vermuten, dass politische Entscheidungen und das Verhalten von Individuen immer in Wechselwirkung miteinander stehen. Doch vergleicht man die Thematik beispielsweise mit der Debatte um den Ausstieg aus der Atomkraft oder die Einführung eines Mindestlohns, zeigt sich schnell, dass diese Probleme in erster Linie Entscheidungen auf politischer Ebene voraussetzen und von dem „korrekten“ Verhalten Einzelner unberührt bleiben.
Veränderungen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene
Aus dieser Perspektive scheint der Vorwurf an Klimaaktivist*innen berechtigt. Doch Rehmann-Sutter spricht eine zweite Sichtweise an: Dass auch die Aktivist*innen in einer Welt leben, deren Rahmenbedingungen von politischen Entscheidungen bestimmt werden: „Wo sollte denn Greta Thunberg ein Toastbrot gefunden haben, das nicht in Plastik verpackt ist?“ So argumentieren auch viele, die beispielsweise die Einführung einer CO2-Steuer fordern. Solange es Flüge gibt, die billiger sind als Bahn- oder Busreisen, sei den Verbraucher*innen nicht vorzuwerfen, dass sie diese Angebote nutzen. „Menschen sind eingebunden in soziale Verhältnisse, in Machtstrukturen, in Situationen und ihre Notwendigkeiten, die sie nicht selbst gemacht haben. Eine CO2-Steuer ist ein politisches Gestaltungsinstrument, das die Anreize in die richtige Richtung verschieben soll“, sagt der Bioethiker.
Die Steuer hat demnach das Ziel, ökonomische Anreize dafür zu setzen, dass wir weniger klimaschädliche Produkte konsumieren. Ob wir uns also selbst für ein „besseres“, klimaneutrales Verhalten entscheiden oder durch die Politik darin gefördert werden – eine Lösung des Klimaproblems erfordert in jedem Fall eine Änderung unseres individuellen Verhaltens und unserer persönlichen Lebensweise. Wie einzigartig diese Verknüpfung ist, zeigt sich auch darin, wie gesellschaftlich auf Forderungen reagiert wird, die auf eine Änderung klimaschädlicher Praktiken abzielen.
Als die Grünen in diesem Jahr ein Verbot von Einweg-Kaffeebechern und die Vernichtung von Retouren durch Onlinehändler ins Gespräch brachten, tauchte in den Medien der Begriff der „Verbotspartei“ wieder auf. Die Partei wurde bereits 2013 mit dem Begriff bedacht, nachdem sie die Einführung eines „Veggie Days“ in Kantinen gefordert hatte. Nicht verwendet wird der Begriff hingegen, wenn es beispielsweise um die Einschränkung des Asylrechts oder die Kürzung von Sozialleistungen geht. Das mag daran liegen, dass solche Maßnahmen immer nur bestimmte gesellschaftliche Gruppen betreffen. Klimapolitische Maßnahmen hingegen zielen auf die gesamte Gesellschaft ab.
Systemveränderung statt individueller Verantwortung?
Einige Initiativen wie beispielsweise das Aktionsbündnis system change not climate change halten Maßnahmen, die nur ökonomische Anreize setzen, für nicht ausreichend. Solange wir in einem System leben, das darauf ausgerichtet ist, immer mehr und mehr Wachstum zu produzieren, seien Maßnahmen wie eine CO2-Steuer nur Symptombekämpfung. Stattdessen fordert das Bündnis einen Paradigmenwechsel: „Kern einer sozial gerechten Antwort auf die Klimakrise muss eine radikale Umverteilung von Arbeit, Zeit, Einkommen und Vermögen sein“, sagt Lukas Liebmann von system change not climate change.
Doch wäre ein solches System in der Lage, uns die individuelle Verantwortung bei der Lösung der Klimakrise zu nehmen? Die Tatsache, dass wir in ein Wirtschaftssystem eingebunden sind, das nach der Logik von Wachstum und Profit funktioniert, können wir aus einer Fülle ständig verfügbarer Produkte auswählen. Eine Änderung dieses Systems, würde bedeuten, dass wir unseren Lebensstil nicht in dem Maße weiterführen können, wie wir es derzeit tun.
Nachhaltigkeit als Optimierung
Liebmann ist der Meinung, dass Entscheidungsfreiheit nur scheinbar mit Nachhaltigkeit in Konflikt steht. Ziel einer umfassenden Veränderung sei die Entschleunigung des Industriesystems. Stetiger Wachstum setze auf kurze Lebenszeiten von Produkten, um den Verkauf von immer neuen Gütern zu fördern: „Produkte und Infrastrukturen könnten durch Nutzungsdauerverlängerung so optimiert werden, dass ohne zusätzliche materielle Produktion Werte geschaffen werden“. Auch Rehmann-Sutter plädiert für eine Ökonomie der Qualität statt der Quantität. Gäbe es eine wirksame Strategie, die neue Technologien in einem Zusammenhang mit deren Herkunft und Folgen denkt, dann brauche es „vielleicht viel weniger Produkte, die aber besser sind und insgesamt weniger Emissionen verursachen“.
Doch Rehmann-Sutter glaubt auch, dass wir unsere Rolle nicht allein auf die von Konsument*innen reduzieren dürfen: „Wie erbärmlich ist das denn? Wir sollen brave Verbraucher*innen sein und uns um nichts weiter kümmern als um den nächsten Konsum.“ Er sieht uns stattdessen als aktive Mitbürger*innen in der Verantwortung. Jede politische Maßnahme in demokratischen Verhältnissen sei nur so lange möglich, als sie von den Betroffenen auch gefordert werde: „Das bedeutet, dass die Einzelnen auch in ihrem eigenen Verhalten eine politische Verantwortung tragen, ohne die eine Veränderung der Gesellschaft nicht möglich ist“, sagt Rehmann-Sutter.
Statt das Konsumverhalten der Fridays-for-Future-Aktivist*innen unter die Lupe zu nehmen, könnte geprüft werden, inwiefern sie sich für ein gesamtgesellschaftliches Umdenken einsetzen und ihren politischen Forderungen Gehör verschaffen. Dass dies geschieht, können wohl selbst Kritiker*innen der Bewegung nicht abstreiten.
Illustration: Michael Weinlein