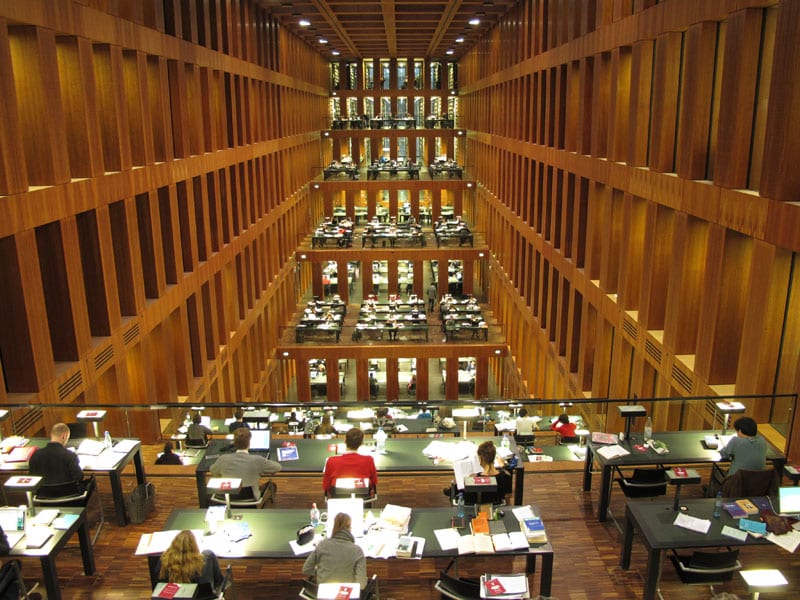Einst galt der Anzug als bürgerliches Kleidungsstück schlechthin. Seit den 60er Jahren jedoch verschwindet er zunehmend aus dem öffentlichen Raum. Lässt sich diese Entwicklung als große Befreiung von repressiven Kleiderordnungen verstehen? Oder liegen auch im Tragen von Anzügen emanzipatorische Möglichkeiten?
„Nachmittags im Smoking? Das tun doch sonst nur die Tiere.“ Wer in Thomas Manns frühen Erzählungen bereits zum Five o’clock tea im Smoking, dem kleinen Gesellschaftsanzug des Abends, erscheint oder den Unterschied zwischen Smoking und Jackett nicht kennt, dem wird in ironischem Ton „Einfalt und Naturnähe“ attestiert. Bei Thomas Mann, der selbst beim Schreiben seiner Erzählungen Anzug trug, werden die verschiedenen Spielarten dieses Kleidungsstücks zum Inbegriff des zivilisierten und gesitteten Bürgertums: „Der weltgültige Abendanzug, eine Uniform der Gesittung, faßte äußerlich die Spielarten des Menschlichen zu anständiger Einheit zusammen“, heißt es entsprechend in der Novelle Der Tod in Venedig.
Diese „Gesittung“ hat jedoch ihre Schattenseite. Die Geschichte des Anzugs ist nämlich nicht von den Strukturen kapitalistischer Ausbeutung zu trennen. Anders als Gustav von Aschenbach, die fiktive Hauptfigur in Thomas Manns Novelle, kann die große Mehrheit ihren Urlaub nicht – gekleidet in den weltgültigen Abendanzug – im Grand Hotel des Bains am venezianischen Lido verbringen. Nur ein kleiner, privilegierter Kreis des hohen Bürgertums profitiert von den Vorzügen der mondänen „Gesittung“. Ist der Anzug – so stark mit dem patriarchalen Bürgertum und dessen Ausbeutungsformen verwachsen – damit endgültig kompromittiert? Es scheint so. Der Sozialphilosoph Max Horkheimer hat 1916 die problematischen Bedingungen der Anzugsproduktion folgendermaßen auf den Punkt gebracht: „Du schläfst in Betten, trägst Kleider, deren Herstellung wir mit der Tyrannenpeitsche unseres Geldes von Hungernden erzwingen, und Du weißt nicht, wieviele Weiber bei der Herstellung des Stoffes für Deinen ‚Cut‘ neben die Maschine gefallen sind.“ Gerade Frauen also sind die Ausgebeuteten und arbeiten sich bei der Herstellung eines männlich konnotierten Kleidungsstücks regelrecht zu Tode. In Zeiten von billiger Massenproduktion und Fast Fashion sind schlechte und ausbeuterische Produktionsbedingungen allerdings nicht nur ein Problem des Anzugs, sondern bestehen mindestens ebenso sehr bei der Produktion von Hoodies und Jogginghosen.
Schöne neue Kleiderordnung? Hoodie und Jogginghose lösen den Anzug ab
Längst ist der Kapitalismus dem Anzug entwachsen. Bereits in Thomas Manns letzter, 1953 veröffentlichter Erzählung Die Betrogene zeichnet sich ein Wandel der Kleiderordnung ab: Der junge Amerikaner Ken Keaton besitzt keinen evening dress mehr, denn „ohnehin hatten die gesellschaftlichen Sitten sich seit Jahren gelockert, weder in der Theaterloge noch bei Abendgesellschaften war der Smoking mehr strikte Vorschrift“. Eine Entwicklung, die sich fortgesetzt hat. Spätestens seit den 60er Jahren ist der Anzug immer stärker aus der Öffentlichkeit verschwunden. Wer heute im Anzug das Theater besucht, gehört eher zu den Ausnahmen; der Smoking gar ist ganz verschwunden. In zuweilen erstaunlicher Offenheit zeugt die Marketing-Sprache der Unternehmensberatungen von einem neuen Status quo, so etwa eine Ausgabe des Porsche Consulting Magazins: „Statt bürokratischem Anzugzwang ist eher der bequemere Hoodie modische Pflicht. Bequem gekleidet denkt es sich gleich auch viel leichter.“ Was als Befreiung von bürokratischen Kleidungsvorschriften auftritt, ist Teil einer neuen „Pflicht“, die durchaus genauso repressiv sein kann wie der alte „Anzugzwang“.
Theodor W. Adorno jedenfalls hätte scharf widersprochen, dass es sich – gekleidet in einen bequemen Hoodie – leichter denken lässt. Gerade er beharrte bei aller Kritik am Bürgertum, das sein Denken prägte, auf der Formalität des Anzugs. Die Korrektheit der Formen (und dazu zählt das Tragen des Anzugs) war für Adorno Mittel der Distanzwahrung. So deutet es Volker Gerhardt, der einst bei Adorno studierte, in einem Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur: „Ich sehe darin den Versuch, eine Ahnung von Distanz gegenüber den Lebensformen deutlich zu machen, die für ihn wichtig war. Indem man einfach durch Überkorrektheit und Zeichen einer gewissen Formalität die Nähe, das Aufgehen in den Verhältnissen zu vermeiden sucht.“ Das Tragen des Anzugs ermöglicht also Distanz und damit Freiräume zur Reflexion und Kritik. Das Verschwinden des „Anzugzwangs“ dagegen ist aus dieser Perspektive lediglich eine vermeintliche Befreiung: Bequem gekleidet zu sein heißt einverstanden zu sein.
„Ich gehe mich einen Dreck an!“: Der Anzug als emanzipatorisches Kleidungsstück?
Wenn das Anzugtragen nur als lästiger Zwang empfunden wird, gerät in Vergessenheit, dass es durchaus auch emanzipatorische Möglichkeiten eröffnen kann. Um ein Beispiel zu nennen: Zweifellos könnte man einwenden, dass der Anzug die geschlechtliche Binarität innerhalb der Modewelt verstärkt hat. Er war nicht nur das bürgerliche, sondern auch das männliche Kleidungsstück schlechthin. Gerade solche festen Zuschreibungen erlauben aber immer auch ihre spielerische Umwertung. Marlene Dietrich etwa hat diese männliche Codierung schon in den 1930er Jahren nachhaltig unterlaufen. Gekleidet in maßgeschneiderte Anzüge zeugte sie von einem Modeverständnis, das Kleidung weder den eigenen Bequemlichkeiten anpasst noch als authentischen Ausdruck ihrer Träger*innen versteht. In geradezu emanzipatorischer Geste beharrte die Schauspielerin darauf, dass Mode immer auch Maske, Verkleidung und eben Schauspiel ist und nicht Ausdruck ihrer Identität als Frau. Eine Haltung, die sie in ihrem berühmten Satz „Ich gehe mich einen Dreck an!“ zusammengefasst und die nicht zuletzt den Anzug auch für Frauen salonfähig gemacht hat.
Noch einmal zurück zu Thomas Mann: Parallel zu seiner Erzählung Die Betrogene nahm er die Arbeit an seinem Roman Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull wieder auf. Als Felix Krull durch Diebstahl genügend Geld besitzt, legt er sich natürlich einen Smoking-Anzug zu, „um darin von Zeit zu Zeit, gleichsam versuchs- und übungsweise ein höheres Leben zu führen“. Das Tragen des Anzugs wird hier zu einem hochstaplerischen Spiel mit Rollen, das das klassistische und patriarchale Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft untergräbt. Vielleicht sollte man die Haltung Theodor W. Adornos, Marlene Dietrichs und Felix Krulls also als emanzipatorische Möglichkeit verstehen. Vielleicht ist es trotz aller Verstrickungen in patriarchale und ausbeuterische Bürgerlichkeit an der Zeit, ein Loblied auf die kritische Distanz und den spielerischen Umgang mit Gender- und Klassenrollen anzustimmen – kurzum: ein Plädoyer für den Anzug.
Foto: Bundo Kim / unsplah