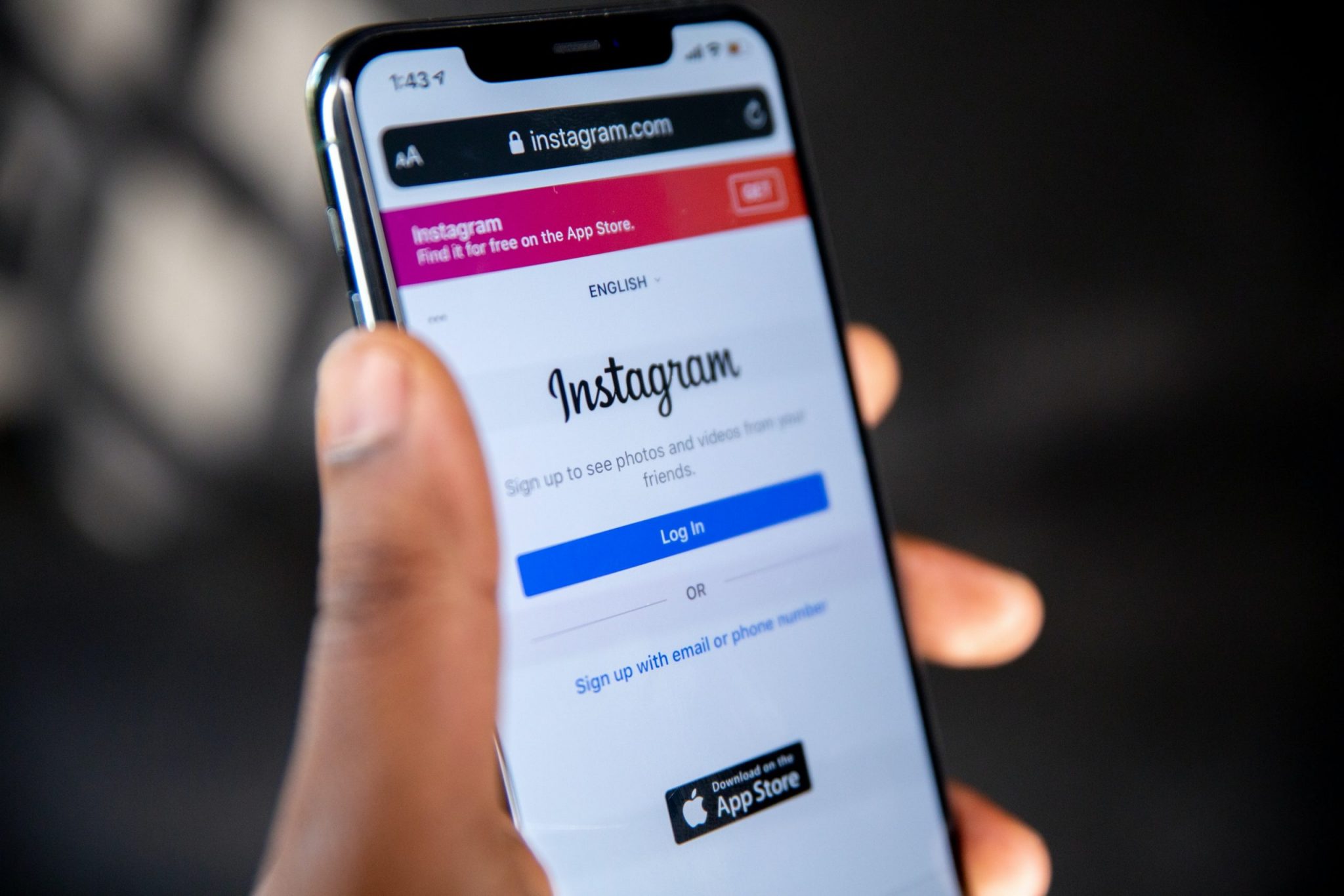Wie verändert das Deinstallieren von Instagram auf dem Handy meine Wahrnehmungen im Alltag? Höhen und Tiefen aus den ersten Wochen ohne Social Media – oder was es bedeutet, nicht mehr That girl sein zu müssen.
Ein paar Wochen sind vergangen, seit ich Instagram Adieu gesagt habe. Noch immer halte ich standhaft an meiner Entscheidung fest. Allerdings wurden auch einige Erwartungen an das Vorhaben enttäuscht. Allen voran steht die bittere Erkenntnis, dass es neben Instagram definitiv auch andere verlockende Möglichkeiten gibt, zu prokrastinieren – YouTube lässt grüßen. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass das stundenlange Konsumieren der Markus Lanz-Talkshow immer noch (minimal) anregender und produktiver ist als apathisches Scrollen durch Tanz- und Katzenvideos. Meine Bildschirmzeit beläuft sich jetzt auf deutlich weniger Stunden als vor dem Instagram-Detox – trotz Lanz und Co.
Klar, „produktives“ Prokrastinieren ist immer noch eine Form des Prokrastinierens, aber ich feiere auch kleine Schritte. Zum Beispiel wird meine Bachelorarbeit durchschnittlich täglich um einen Satz länger, was zwar nicht meinen Erwartungen entspricht, aber immerhin schreibe ich überhaupt daran. Wider Erwarten habe ich auch keine zwölf Romane gelesen – aber immerhin anderthalb. Vor dem Verzicht wären es definitiv weniger gewesen.
Blaulicht und Zuckowski
Generell merke ich, wie meine Konzentrationsfähigkeit Stück für Stück zunimmt. Durch die gefürchtete Zeit am Schreibtisch quäle ich mich wieder ohne ständige Handy-Pausen. Den Haushalt erledige ich zwar genauso freudlos, aber deutlich schneller als vorher. Auch Filme lassen sich ohne Unterbrechung schauen – fast hätte ich vergessen, wie es sich anfühlt, darin zu versinken. Und es gibt noch eine andere große Wiederentdeckung: Das Hören von Musik ist so viel intensiver ohne Social Media. Das fortdauernde Scrollen stumpfte meine auditive Wahrnehmung ab, davon bin ich jetzt felsenfest überzeugt. Plötzlich achte ich wieder auf Liedtexte, google öfter nach den Lyrics. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich mich fast in meinem alten Kinderzimmer neben dem CD-Player liegen – vor mir das aufgeschlagene Liederheft von Rolf Zuckowskis Lieblingshits.
Außerdem ist es ausnahmsweise wirklich wahr, was einem gerne von älteren Generationen eingehämmert wird: Ohne den exzessiven Blaulicht-Konsum am Abend schläft es sich besser, das gebe ich zu. Die Augen werden einfach schneller müde.
That girl
Ein kleines Erfolgserlebnis hatte ich neulich am Görlitzer Bahnhof. Es war etwa 19 Uhr, als ich aus der Bahn stieg. Das Wetter war schön, ein klarer Oktobertag. Auf dem Gleis drängten sich die Leute und ich wusste sofort, warum. Die Sonne ging unter und tauchte die Stadt in abendliches Licht. Rot und Orange am Himmel erschienen mir strahlender als sonst. Vielleicht, weil ich es nicht durch einen Bildschirm betrachtete? Denn alle anderen zückten ihre Handys, um das leuchtende Naturspektakel einzufangen. Sie überschritten für das perfekte Bild sogar die weiße Sicherheitslinie.
Nur ich lief erhaben an der Menschentraube vorbei. Denn wozu brauche ich hunderte verschwommene Fotos in meiner Handygalerie, wenn ich sie nicht mehr mit anderen teile? Früher hätte ich eine Story hochgeladen, das Bild womöglich noch musikalisch mit einem Pop-Song untermalt (vielleicht ja mit „Golden“ von Harry Styles?). Heute lasse ich das Handy lieber in der Tasche oder manchmal sogar – ganz gewagt – direkt zu Hause. Denn Sonnenuntergänge, Regenbögen und im Übrigen auch Selbstportraits müssen nicht zwanghaft und bei jeder Gelegenheit dokumentiert werden. Es sei denn, man arbeitet gerade an einem autobiographischen Bildband.
Neben der Zeit-Problematik hatte mich noch etwas Fundamentales an Instagram gestört: der ständige Druck, sich mitzuteilen. Mich immer zu äußern, immer zu posten, immer alles festhalten zu müssen. Natürlich hat das ständige Teilen von Momenten mitunter auch Spaß gemacht. Manchmal vermisse ich es, durch mein eigenes Story-Archiv zu scrollen, um in Erinnerungen an Vergangenes zu schwelgen. Vor einem Jahr war ich hier, vor zweien dort. Nur hatte dies mitunter ungesunde Ausmaße angenommen. Ich habe irgendwann nicht mehr für mich selbst gepostet, sondern wollte anderen ein bestimmtes Bild von mir vermitteln. Um es in adäquater Instagram-Sprache auszudrücken: Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr darauf konzentriert, that girl zu werden (was auch immer das heißen soll). Und das machte mich unglücklich. Ein Instagram-Profil kann durchaus als eine Art Tagebuch fungieren – nur sollte es besser nicht zur Visitenkarte werden.
Foto: Solen Feyissa/ unsplash