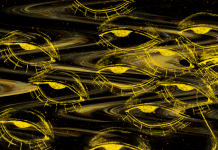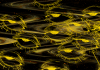In Kindheitstagen erträumen wir uns vieles. Dass uns diese Visionen abhandenkommen oder dass wir uns gar davor fürchten, sie in die Tat umzusetzen, wirft die Frage auf, ob das, was uns am meisten im Weg steht, unser Selbstbewusstsein ist.
Es heißt, Kinder haben es leichter, zu träumen. Nicht nur, weil ihnen eine weitreichendere Fantasie zugeschrieben wird als den meisten Erwachsenen. Nicht mal nur aus dem Grund, dass kindliche Träume und Zukunftsvisionen später oft als naiv vermaledeit werden. Vielleicht geht es auch um den Zeitfaktor an sich. Ist es nicht generell leichter, von etwas zu träumen, das weit weg liegt? Womöglich fangen die ganzen Visionen nicht an zu bröckeln, weil wir zeitgleich mit dem Führerschein einen Fantasieverlust entgegennehmen, sondern, weil wir auf einmal theoretisch in der Lage wären, die ersten Schritte dessen in Angriff zu nehmen, was wir als den Weg zum Ziel erachten. Der Abstand zwischen uns selbst und der Person, die alt genug, gebildet genug, selbstständig genug wäre, um diesem Kind seinen Wunsch zu erfüllen, ist auf einmal erschreckend klein.
Klar ist, dass uns eine ganze Menge zwischen uns und unsere Träume kommt. Viele von uns beginnen nach der Schule mit etwas, das nicht oder nicht wirklich oder nur halb auf das hinführt, was wir im Endeffekt gerne tun oder sein würden. Und wenn doch, dann kommen zumindest Miete zahlen, Wäsche aufhängen, Beziehungen und andere zeitaufwendige Dinge hinzu, die wunderbar als Ablenkung genutzt werden können.
Es ist so schön einfach, sich an all den Alltagsstrapazen aufzuhängen und ein unerschöpfliches “Ich bin ein Opfer der Krankheit unseres Zeitalters”-Narrativ zu pflegen, das es uns erlaubt, aus Leistungsdruck, Zeitdruck, unvergleichlicher Bildschirmzeit und vielem mehr ein Team zusammenzustellen, welches für das Scheitern unserer Träume zur Verantwortung gezogen werden kann.
Nun ist es ein wohlbekannter Nebeneffekt der erwähnten Bildschirmzeit, dass wir zum Beispiel auf sozialen Medien mit eben den Menschen konfrontiert werden, die in ihrer Caption bereits den Titel dessen anschlagen, was wir einmal sein wollen. Nur scheint der Weg dorthin irgendwie unsichtbar. Dort steht zum Beispiel “Autor*in” und nicht “Ich habe seit fünf Jahren on und off ein paar Minuten am Tag geschrieben”. Und nicht nur auf Social Media: Wann immer wir jene Legenden sehen, in deren Fußstapfen wir treten wollen, scheint sich eine riesige Lücke aufzutun, zwischen dem Punkt, an dem wir stehen, und dem, an dem wir sein wollen. Wir fokussieren den einen Faktor, der uns von all diesen Menschen unterscheidet: Es geschafft zu haben oder es noch nicht geschafft zu haben. Wir gehen mit einem unguten Gefühl ins Bett, verfallen klammheimlich in Panik, wenn Freund*innen uns von ihrem ersten Durchbruch erzählen und verlieren stetig den Bezug zu dem, was es eigentlich bedeutet, unseren Traum in die Hand zu nehmen. Aber wieso?
Prokrastinieren wir vielleicht nur aus dem Grund, weil wir Angst haben, den Durchbruch gar nicht schaffen zu können? Ist es unsere größte Angst, festzustellen, dass wir in Wirklichkeit gar nicht gut genug sind, um uns den eigens kreierten Traum zu erfüllen? Liegt das Problem des Ganzen also gar nicht darin, dass wir abgelenkt werden, sondern darin, dass wir hoffnungslose Perfektionist*innen sind, die sich gar nicht erst mit Mittelmaß oder Scheitern assoziieren wollen? Wenn wir uns tatsächlich nur davor fürchten, uns selbst zu enttäuschen, dann sollte die Lösung des ganzen Dilemmas relativ einfach sein: Irgendwie anfangen. Nichts ist enttäuschender, als gar nichts zu tun, also sollte sich der Anspruch an die ersten Schritte in Grenzen halten.
Dieser Text ist in der UnAufgefordert #257 zum Thema Träume und Zukunft erschienen. Weitere Beiträge aus dem Heft lest ihr hier.
Illustration: Isabelle Aust