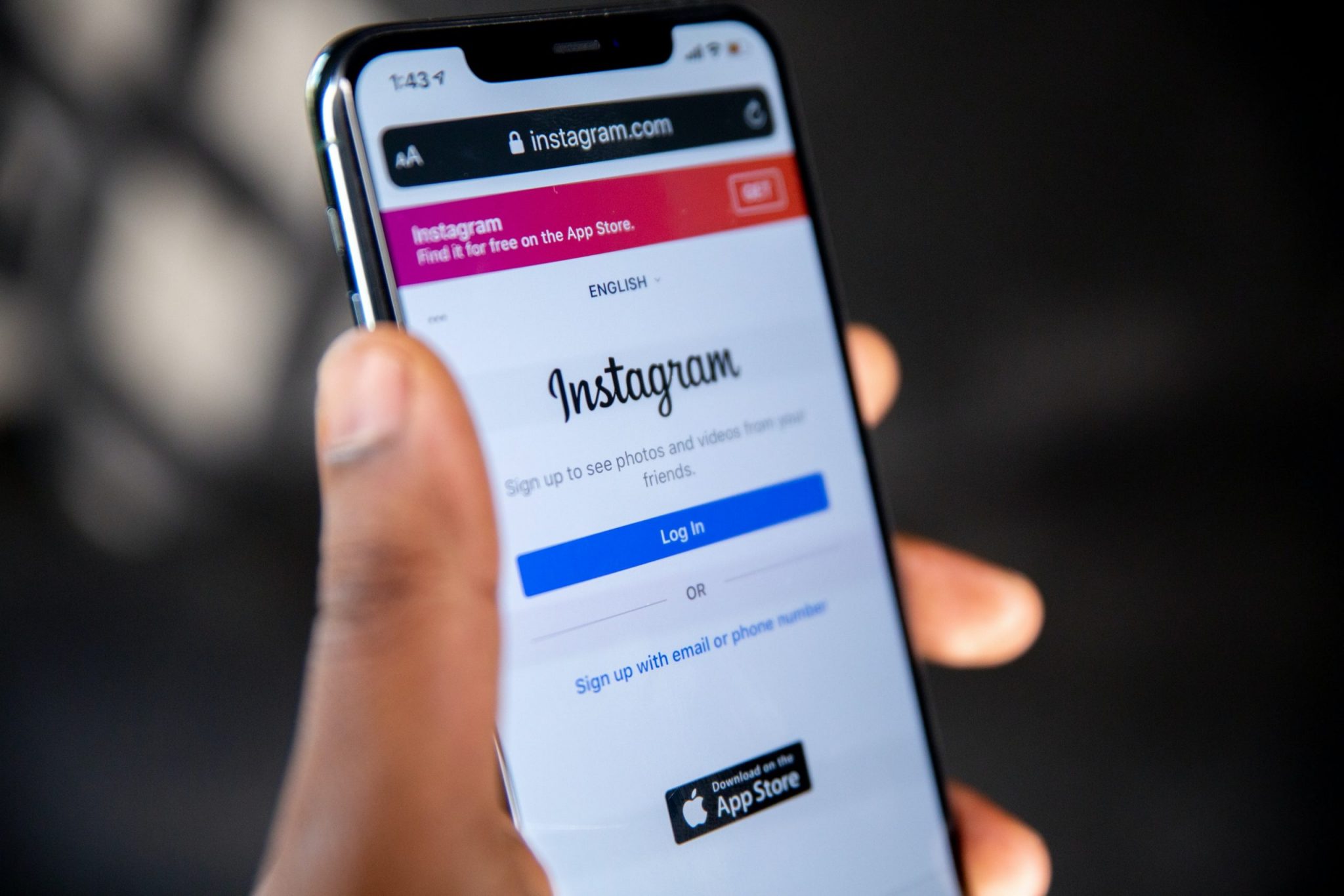Ich starte ein Experiment: Auf Instagram verzichten. Möglichst lange, am besten aber für immer. In dieser Kolumne teile ich meine Erfahrungen mit dieser Entscheidung, und wie sie sich auf mein (Uni-)Leben auswirkt.
Eine Woche ist es her, dass ich mein Instagram-Profil deaktiviert habe. So melodramatisch es auch klingen mag: Die Entscheidung ist, das spüre ich jetzt schon, einschneidend. Nicht für die Welt, die dreht sich weiter. Genauso wie weiter täglich, sekündlich Content produziert und veröffentlicht wird – nur mein Nutzername fehlt im Storyviewer, und von mir werden auch keine roten Herzchen mehr verteilt. Ich teile mein Leben nicht mehr, zumindest nicht mit Menschen, die ich kaum kenne: keine Fotos und keine Updates. Wer nicht meine Nummer und ernsthaft freundschaftliches Interesse an mir hat, hat keinen blassen Schimmer, was ich gerade treibe. Ich bin wieder anonym und auch wenn mein plötzliches Verschwinden vermutlich deutlich weniger Leuten den Schlaf raubt als ich es in meiner Ich-Zentriertheit denken würde, fühlt sich das befreiend an, friedlich. Aber auch ein bisschen beängstigend, denn ich habe plötzlich sehr viel Zeit.
Zugegeben, die Entscheidung, der App auf Nimmerwiedersehen zu sagen (eine Reaktivierung schließe ich übrigens aus, Rückfälle werden nicht geduldet) kam sehr abrupt. Eines Tages (letzte Woche) kam ich aus einem erholsamen Urlaub zurück, setzte mich an meinen chaotischen Schreibtisch, klappte meinen mit Staub besetzten Laptop auf und wollte das tun, was ich seit Wochen konsequent verdränge: meine Bachelorarbeit schreiben.
Das leere Dokument strahlt mich so blendend weiß an, dass ich die Helligkeit schwächer stellen muss. Ich verspüre ein leichtes Ziehen im Arm, der erste Anflug von Panik. Ich weiß, was zu tun ist: Zum Handy greifen. Für ein paar Minuten (oder waren es Stunden?) scrolle ich, die Panik legt sich wieder. Ich denke nicht nach, denn ich schaue Reels. Mein Blick fällt zu keiner Zeit auf den Laptop und die gähnende Leere des Dokuments. Nein, mein Blick gehört einzig und allein dem bunten, flirrenden und lauten kleinen Bildschirm in meiner Hand. Eine blitzschnelle Aneinanderreihung von Bildern, von Eindrücken, die für mein Leben im Grunde wertlos sind – aber einen ausgezeichneten Zufluchtsort vor drückenden Gedanken bilden.
Die Ablenkung ist – natürlich, das kenne ich schon – nur temporär. Irgendwann hebe ich meinen müden Blick wieder und stelle fest, dass das Dokument auf meinem Laptop immer noch leer ist und ich nun extrem schlecht gelaunt bin. Also, Zeit für einen aufheiternden Urlaubspost! Mühsam wähle ich ein paar Bilder von mir und meinen Freundinnen am Strand. Ein Posting mit mehreren Fotos zu erstellen empfinde ich wirklich als äußerst umständlich, dauernd verschiebt sich die Reihenfolge der Bilder. Nervtötende Fingerarbeit, die mich bestimmt zehn Minuten kostet.
So, Ort ist hinzugefügt, Freundinnen sind markiert, der Beitrag ist fast fertig: Die Caption fehlt noch. Ein Glück habe ich auf meinem Handy eine Notizdatei mit dem Namen „Quotes“. Dort sammle ich Zitate aus Büchern und Liedern. Ich entscheide mich für ein Zitat, was dem schönen Urlaubsmoment, den ich gleich mit der Öffentlichkeit teilen werde, gebühren soll. Irgendwas über Endorphine.
Fertig, der Post geht online. Ich schaue ihn mir nochmal genau an, zoome auf die lachenden Gesichter, lese erneut den gewählten Satz in der Caption. Und das ist der Moment, in dem ich kurz überlege, mein Handy aus dem Fenster zu werfen. Ich entscheide mich für die weniger theatralische Variante und lösche Instagram, lösche die App einfach mit ein paar Klicks. Bevor ich anfangen kann, die roten Herzchen zu zählen, die meinen – nun nicht mehr vorhandenen – Post geschmückt hätten. Denn mir ist etwas klar geworden: Das hier, die letzten paar Stunden, die ich auf dieser App vergeudet habe, haben überhaupt nichts mit Endorphinen zu tun. Das Hochladen und Teilen dieses persönlichen Moments, der schon längst der Vergangenheit angehört, löst in mir keine Glücksgefühle aus – im Gegenteil. Es geht hier nicht um Endorphine, es geht um Prokrastination, Eskapismus und vor allem um Abhängigkeit.
Ich will nicht mehr abhängig sein, deswegen starte ich dieses Experiment. Eine Woche habe ich bereits auf Instagram verzichtet und nein, meine Bachelorarbeit habe ich immer noch nicht geschrieben. Was ich aber sagen kann ist, dass es für mich bis jetzt keinen einzigen triftigen Grund gibt, um zur App zurückzukehren. Und ich habe viel, viel mehr Zeit. In dieser Kolumne will ich regelmäßig ehrlich über positive und negative Effekte meines Verzichts berichten, über Fortschritte und mögliche Schwierigkeiten.
Foto: Solen Feyissa/ unsplash