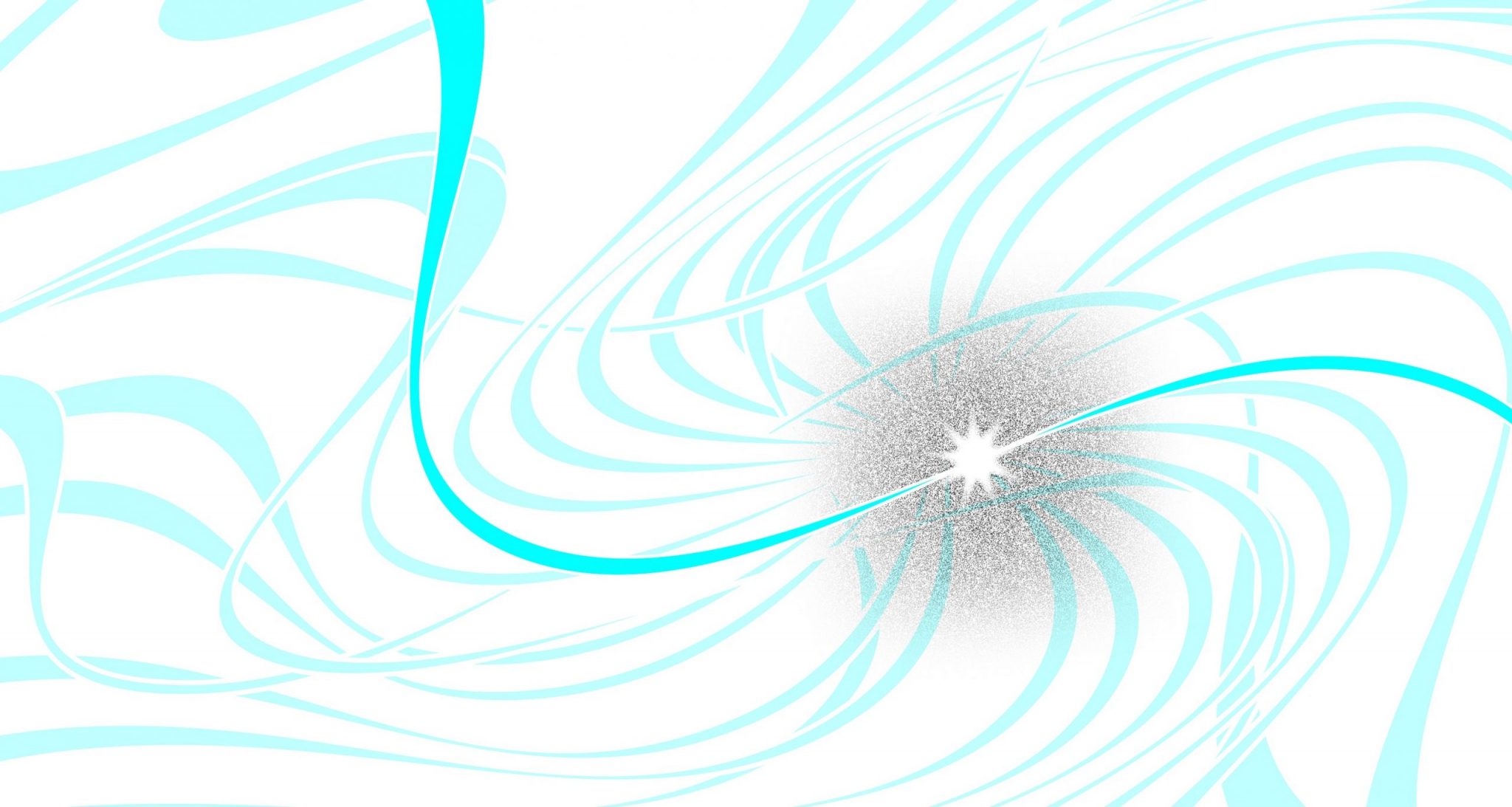Eine „Venus in Furs“ auf der Couch und Reaktionen zur „Red Light Therapy“ — Dominique erklärt, welchen Stellenwert Schnittstellen für sie als Künstlerin und Kunstvermittlerin haben. Dabei im Fokus: Der Widerspruch zwischen Objektivierung und Sexualisierung des weiblichen Körpers als Kunstform.
Dominique beschäftigt sich in ihrer Kunst mit dem eigenen Körper als Ventil für Erfahrungen der Objektivierung und Diskriminierung des weiblichen Geschlechts. In Ihren Kunstwerken, die aus Collagen, Videokunst oder Installationen bestehen, bekommt man als Betrachter*in das Gefühl, ihr Sujet, der eigene Körper, changiert zwischen den Übergängen von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Mit der UnAuf spricht die Künstlerin und Kunstvermittlerin über ihr Interesse an dem Austausch mit dem Publikum, ihre Faszination für den Körper beziehungsweise die Weiblichkeit und erzählt, warum sie sich niemals Künstler*innenkollektiven zugehörig fühlen würde.
„Ich habe mich entschieden Kunst zu machen, als ich mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert war.“
UnAuf: Du bist über Umwege zur Kunst gekommen. Was hast du vor deinem Studium an der UdK gemacht?
Dominique Buege: Ich habe eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht, aber wusste schon immer, dass ich eine kreative Seele habe. Nach der Ausbildung habe ich Volkswirtschaft an der Humboldt Universität studiert. Dann kam der Bruch in meinem Leben. Ich wurde konfrontiert mit der Endlichkeit des Lebens, die mir durch den Verlust geliebter Menschen in meinem Umfeld bewusst gemacht wurde. Damals ist die Frage in meinem Kopf aufgestiegen: „Was mache ich hier eigentlich?“ Und mir wurde auf einmal klar, dass das Leben, in dem ich mich momentan befinde, Fake ist, weil ich etwas nachgejagt bin, das nichts mit mir selbst zu tun hat. Daraufhin habe ich meinen Weg zur Malerei wiederentdeckt. Das ist schon immer der Weg gewesen, wie ich meine Seele gefüttert habe. In der Zeit habe ich ganz exzessiv Tag und Nacht gemalt. Das war auch der Zeitpunkt, an dem ich mich dazu entschieden habe, Kunst zu studieren. Innerhalb einiger Tage arbeitete ich mein ganzes Portfolio aus und reichte meine Bewerbung bei der UdK ein und es hat funktioniert.
Wie bist du letztlich zum Feminismus gekommen und wie hast du die feministische Theorie in deinen Arbeiten umgesetzt?
Das kam erst mit dem Studium, als ich mich ausprobieren wollte und die Kunst als ein Mittel dazu verwenden wollte, eigene Traumata zu verarbeiten. Genauer gesagt habe ich mich mit dem Verhältnis zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen befasst. Gleichzeitig bin ich bereits von der Malerei zur Installation gewechselt und anschließend zum Video als Medium durch die Isolation während der Pandemie. Ich habe angefangen mich sehr viel mit mir und meinem Körper zu beschäftigen und fand so einen intimen Zugang zum Video.
Ich las zum ersten Mal „Das andere Geschlecht“ von Simone de Beauvoir, dort erwähnt sie bereits in der Einleitung, dass es Überschneidungen bei dem Themen der Diskriminierung der Frau und dem Rassismus gibt. Das war zum Zeitpunkt der globalen Black Lives Matter-Bewegung. Für mich waren das leitende Worte und ich entdeckte mehr und mehr Schnittstellen. Ab da habe ich alle Künstlerinnen, die mich inspirierten aus einem feministischen Blickwinkel gesehen. Ich habe sie in einem Ganzen betrachtet und nicht mehr als einzelne Künstlerinnen voneinander getrennt. Vor dieser Erkenntnis fing ich an zu hinterfragen, wie ich arbeiten will und mir wurde klar, dass ich nur als Individuum aus meiner eigenen Perspektive und Erfahrung schöpfen kann. Und zwar als die Frau, die ich bin, ohne vorzugeben etwas zu sein, dass ich nicht bin. So fing ich auch selbst an — peu à peu — in diese Richtung zu arbeiten.
„Red Light Therapy“ war der erste Versuch in diese Richtung. Es ist ein photographischer Print auf einer Fußmatte, dass meine Brust in einer „Red Light Therapy“-Session gegen Schmerzen im Herz zeigt. Dabei habe ich mich selbst im Spiegel beobachtet und war von dem Lichteinfall auf meinen Brüsten sehr angetan. Es war einfach schön mich selbst zu beobachten in dem Rotlicht.
Ich habe mich selbst in diesem Augenblick objektiviert und sexualisiert und als ich das verstand, griff ich zur Kamera, um den widersprüchlichen Moment festzuhalten. So entstand das Bild. Dabei bin ich selbst als Frau permanent der Objektivierung durch andere ausgesetzt, worüber ich mich so oft aufrege, aber in diesem Moment ist genau das passiert: Ich fühlte mich angezogen von der Ästhetik meines Körpers in den roten Lichtstahlen. Ich druckte diese Photographie auf einem Fußabtreter ab und präsentierte es in der Bark Gallery.
„Reden ist für mich das Bindemittel zwischen meiner Kunst und dem Umfeld. Deshalb bin ich Künstlerin und Kunstvermittlerin. Die Begegnung und Schnittstellen herzustellen, das ist für mich das wichtigste.“
Wie würdest du als Kunstvermittlerin die Reaktion deines Publikums auf „Red Light Therapy“ beschreiben?
Das war natürlich eine bewusste Provokation und gleichzeitig eine Einladung, meine Besucher entscheiden zu lassen, wie sie mit dieser Fußmatte umgehen. Die erste impulsive Reaktion war tatsächlich oft: „Oh geil, Titten!!“ und „Red Light Therapy, HAHAHA!“ Ich habe das als einen Scan des weiblichen Körpers eingeordnet, nach dem Motto, ist es attraktiv oder nicht. Dadurch dass da Brüste abgebildet sind, also sekundäre Geschlechtsmerkmale, entstand diese Reaktion.

Die zweite Reaktion war überwiegend das Hinterfragen der Materialität und der Platzierung, also: „Warum handelt es sich um eine Matte und warum liegt sie auf dem Boden?“ Und hier fing erst das Hinterfragen des Werkes als Ganzes an, so zu sagen die „Gedanken-Therapy“. Diese Entwicklungen und Beobachtungen aus meinem Publikum finde ich wichtig und bin deshalb fast immer anwesend bei meinen Ausstellungen. Beispielsweise hat sich eine Künstlerin, die meine Ausstellung besucht hatte, bewusst auf die Matte mit der Abbildung meiner Brüste darauf gestellt, um die Kontroverse noch deutlicher hervorzuheben. Das hat mir sehr gefallen. Wie ich finde, unterzeichnet dieser Akt nochmal die Doppeldeutigkeit: Es ist zwar ein Objekt, das jedoch eine Verletzlichkeit darstellt.
Deine Arbeit „Venus in Furs“ hebt sich ab durch die Materialität, durch die handwerkliche Arbeit dahinter. Welche Empfindungen hattest du, als du an diesem Kunstwerk gearbeitet hast?
Diese Arbeit ist aus einem sehr persönlichen Blickwinkel entstanden, als ich von meiner Mutter einen aussortierten Pelzkragen geschenkt bekommen habe. Ich begann damit und mit einem Stoff aus dem Second Hand Shop zu experimentieren. Ich wollte diese zwei Komponenten zu einer Vulva zusammensetzen und zu einem Kissen verarbeiten, aber mir fehlte noch mehr Stoff. Also habe ich eine Kollegin danach gefragt und fing an mit ihr über das Projekt zu sprechen. Dabei hatte ich eine interessante Beobachtung gemacht. Während des ganzen Gesprächs hatte sie nicht ein einziges Mal das Wort „Vulva“ oder „Vagina“ benutzt, sondern immer irgendwelche alberne Nicknames.

Dabei war sie nur ein paar Jahre älter als ich und hatte bereits zwei Töchter. Ist es nicht verkehrt, dass Frauen wohl immer noch eine Scham verspüren bei diesen Wörtern? Als das Kissen jedoch fertig war, reagierte jeder, der ins Zimmer kam und die Vulva auf der Couch sah, begeistert und hatte kein Schamgefühl gegenüber diesem Kunstobjekt. Diese Scham gegenüber dem eigenen Geschlechtsorgan war letztendlich die Inspiration für mich dieses Projekt zu starten und mehr von diesen Kissen zu nähen. Jedes Kissen ist einzigartig. Es freut mich riesig, dass sich die Kissen mittlerweile bei den unterschiedlichsten Personen ein Zuhause gefunden haben und mehr und mehr in den Umkreis gelangen.
„Was ich gerade sehe, lese oder verarbeite bringt mich dazu neue Formen auszuprobieren.“
Warum arbeitest du gerne alleine und mit deinem eigenen Körper?
Ich beobachte aktuell in der Kunstlandschaft, dass verstärkter die Arbeit von Künstler*innenkollektiven thematisiert wird, weil dadurch die künstlerische Arbeit ernster genommen und das persönliche, individuelle Arbeiten eher zurückgestellt oder sogar abgewertet wird. Das stimmt mich persönlich sehr wütend, wenn ich das wahrnehme.
Ich finde genau damit füttert man den Abstand in der Welt, das sich gegenseitig nicht ernst nehmen, keine Verbundenheit schaffen. Das finde ich schade, denn wir leben in diesem einen Ich, in diesem einen Körper, der Gewalt erfahren kann und es aus sich heraus verarbeiten muss. Wer hat das Recht darauf, das abzuwerten oder aufzuwerten oder generell zu bewerten? Ich finde niemand. Deshalb ist es mir enorm wichtig aus mir heraus zu arbeiten und die Betrachter*innen zum Assoziieren zu bringen und im besten Fall ins Gespräch zu kommen. Eine Schnittstelle zu finden zwischen der Kunst und den Betrachter*innen. Eine Schnittstelle zwischen dir und mir, zwischen uns allen, denn in uns allen gibt es etwas, dass uns verbindet und das möchte ich hervorbringen.
Dominique lebt und arbeitet in Berlin, studiert an der UdK Bildende Kunst und ist Miteigentümerin von Art Tours Berlin.
Foto: Ella Pechechian