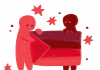Ob Engagierte in einer Bürgerinitiative, Wissenschaftler*innen oder kritische Journalist*innen – sie alle kann es treffen. Was bedeuten SLAPP-Klagen (kurz für „Strategic Lawsuit against Public Participation“) für den öffentlichen Diskurs, wie hängen sie mit aktuellen politischen Entwicklungen zusammen und was kann ihnen entgegengesetzt werden? Dazu haben wir mit Philipp Wissing von der No SLAPP Anlaufstelle in Berlin gesprochen.
UnAuf: Was versteht man unter SLAPP-Klagen?
Philipp Wissing: Bei SLAPP-Klagen handelt es sich um strategisch motivierte, rechtsmissbräuchliche Verfahren, die sich gegen bestimmte Formen von öffentlicher Beteiligung richten. Es werden also rechtliche Schritte eingeleitet, die nicht darauf abzielen, Recht zu bekommen, sondern einzuschüchtern. Dabei geht es nicht um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, sondern dezidiert um Dinge, die von öffentlicher Relevanz sind. Wir orientieren uns hierbei an der Definition der EU-Richtlinie, die letztes Jahr in Kraft getreten ist und auch in Deutschland umgesetzt werden muss.
UnAuf: Was macht die No SLAPP Anlaufstelle?
PW: Die Anlaufstelle ist ein Projekt, das aus dem No-SLAPP-Bündnis hervorgegangen ist. Unsere Kooperationspartner bieten verschiedene Veranstaltungen an, in denen es um Prävention, Sensibilisierung und Aufmerksamkeit geht. Wir können selbst keine juristische Beratung anbieten, aber wir können Betroffene an unseren rechtlichen Beirat vermitteln; wir dokumentieren Fälle online und vernetzen akademisch Forschende mit Journalist*innen, Rechtsanwält*innen und verschiedenen Organisationen.
UnAuf: Inwiefern schränken SLAPP-Klagen kritischen Journalismus und Pressefreiheit ein?
PW: SLAPP-Klagen schränken kritischen Journalismus dahingehend ein, dass ein Einschüchterungseffekt entsteht und Menschen sich tendenziell immer weniger trauen, über bestimmte Dinge zu recherchieren und zu berichten. Das erzählen uns viele Journalist*innen, mit denen wir sprechen. Diskussionen finden so oft nicht mehr im öffentlichen Raum statt, sondern gehen sehr schnell vor Gericht. Das begreifen wir als Verrechtlichung des öffentlichen Diskurses – und diese Entwicklung ist problematisch und im Sinne autoritärer Agenden. Auch wenn Richter*innen im Sinne der Tatsachen entscheiden, wird das Urteil autoritär gesetzt, anstatt, dass ein freier, demokratischer, öffentlicher Diskurs stattfindet. Verrechtlichung bedeutet auch eine ungleiche Ressourcenschlacht: Sehr wohlhabende, ressourcenstarke Akteur*innen – etwa Firmen, Einzelpersonen oder politische Akteur*innen – stehen ressourcenschwächeren Akteur*innen, wie freien Journalist*innen und kleinen Medienhäusern, gegenüber. Wenn SLAPPs erfolgreich sind, führt das zu einem Chilling-Effekt: Der Diskurs zu kritischen Themen wird verringert, weil Journalist*innen mit potenziell existenzbedrohenden Forderungen konfrontiert sind.
UnAuf: Welche journalistischen Themen sind besonders betroffen?
PW: Von SLAPPs betroffen sind auf jeden Fall Recherchen zu rechten und rechtsextremen Akteur*innen. So nutzen rechte Akteur*innen diese Strategie besonders gerne bei Diskussionen, bei denen sie wissen, dass etwas öffentlich schwierig zu vermitteln ist. Ein Beispiel dafür ist der Fall, in dem Chatverläufe rechtsextremer, ehemaliger Mitarbeitender von AfD-Abgeordneten offengelegt und journalistisch aufgearbeitet wurden. Solche Chatverläufe lassen sich schwer öffentlich verteidigen. Dann wird versucht, das Thema durch SLAPP-Verfahren aus der Öffentlichkeit herauszubekommen.
Auch der Bereich Aktivismus, vor allem Umweltaktivismus, ist betroffen. Das sieht man gerade sehr deutlich an einem Fall, bei dem ein Journalist eine Protestaktion bei einem Kohlekraftwerk fotografisch begleitet hat und jetzt von RWE, also einem großen Energiekonzern, genauso belangt wird, als wäre er Teil der Aktion gewesen. Außerdem haben wir im Bereich des investigativen Journalismus mehrmals von rechtlichen Schritten gehört, die gegen Journalist*innen eingeleitet wurden.
Wenn wir uns anschauen, was geslappt wird, dann handelt es sich also um progressivere, liberale Vorstellungen von gesellschaftlicher Gestaltung. Allein den Schritt zu machen, die Dinge zu verrechtlichen und nicht zu diskutieren, ist schon Teil von autoritärem Handeln.
Das sind die Themen, die uns begegnen, repräsentativ festmachen können wir das aber nicht.
UnAuf: Die von der EU beschlossene Richtlinie enthält erstmals eine Definition von SLAPPs, allerdings beschränkt sie sich ausschließlich auf Fälle, die über Staatsgrenzen hinausgehen. Welche juristischen Maßnahmen hältst du für sinnvoll, um gegen SLAPPs vorzugehen? Und wie können wir auch abseits von juristischen Maßnahmen SLAPP-Prävention in gesellschaftlichen Debatten verankern?
PW: Auf der juristischen Ebene denken wir, dass Early-Dismissal wichtig ist, also die frühzeitige Beilegung von SLAPPs. Denn Betroffene leiden durch die Verfahren über sehr lange Zeit unter psychischer Belastung. Außerdem muss das Kostenrisiko durch Entschädigungen für Betroffene oder Missbrauchsgebühren gesenkt werden, wenn Rechtsmissbrauch festgestellt wird. Das ist wichtig, um Betroffene zu unterstützen und gleichzeitig die Anreize für SLAPP-Klagen zu verringern. Entscheidend ist des Weiteren, dass der Staat Anlaufstellen wie unsere langfristig fördert.
Die No Slapp Anlaufstelle bietet außerdem konkrete Fortbildungen an, bei denen sich Menschen mit zivilrechtlichen Bestimmungen vertraut machen können. Unser Aufruf an NGOs, Initiativen, kleine publizistische Einrichtungen und Blogs ist, sich gemeinsam auf den Konflikt vorzubereiten und Geld kollektiv zurückzulegen. Es ist wichtig, sich gegenseitig nicht alleine mit diesen Fällen zu lassen. Solidarität ist die beste Verteidigungsstrategie. Und deswegen ist unser wichtigster Appell, nicht zu viel Angst zu haben. Denn man kann diese Formen von rechtsmissbräuchlicher Einschüchterung gut abwehren.
UnAuf: Was denkst du, haben SLAPP-Klagen und kritischer Journalismus mit Mut zu tun?
PW: Einerseits ist es für mich ermutigend, zu sehen, wie viele Menschen sich öffentlich gegen autoritäre und rechtsextreme Formierungen stellen, vor allem auch durch investigative Recherchen. Das ist ganz wichtig, um Dinge greifbar und diskutierbar zu machen. Andererseits muss man im besten Fall gar nicht so mutig sein, sondern organisiert sich in journalistischen Kollektiven, Bürgerinitiativen, politischen oder gewerkschaftlichen Gruppen, um diesen Mut kollektiv aufzubringen. Kritisches Engagement sollte in einer demokratischen Öffentlichkeit eigentlich selbstverständlich sein. Da diese Selbstverständlichkeit aber gerade massiv angegriffen wird, müssen sich Menschen mehr dahingehend organisieren, diese Konflikte kollektiv führen zu können und resilient zu werden – sodass die Verteidigung kritischer, demokratischer Diskurse eben nicht am Mut Einzelner hängt.
Illustration: Lotte Koterewa.