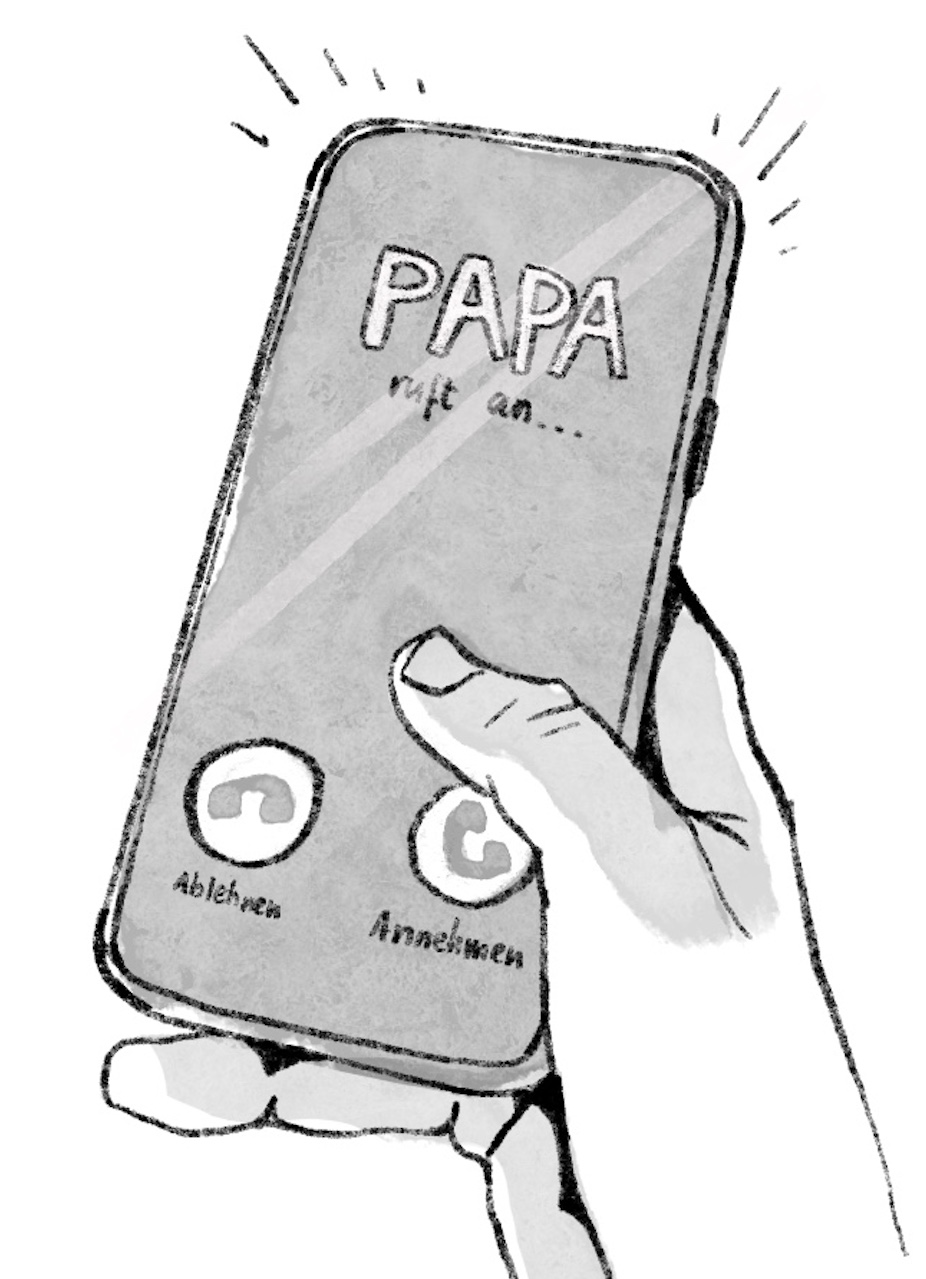Er lebt, doch ich habe ihn längst verloren. Der Alkohol hat meinen Vater und mich entfremdet. Jetzt frage ich mich, ob Loslassen mutiger ist als Festhalten.
Triggerwarnung / Content Note Suchterkrankungen, Suizid, Depressionen
Jedes Mal, wenn ich ihn anrufe, hoffe ich insgeheim, dass er nicht rangeht. Die Mailbox ist meine Erlösung, denn ich lege auf, ehe er unseren Familiennamen aussprechen kann. Doch gestern beim vierten Versuch, eine Woche nach seinem Geburtstag, hebt er ab. Das letzte Mal haben wir vor drei Monaten gesprochen, kurz nach meinem Geburtstag. Damals hatte er unser Treffen kurzfristig abgesagt. Ich war längst da, als er mir erklärte, zu krank zu sein. Zu krank. Das bedeutet: zu betrunken.
Heute erfahre ich, dass er seit Februar arbeitslos ist. Der Arbeitsvertrag sei einvernehmlich beendet worden. Arbeitslosengeld könne er erst ab Juni bekommen, Bürgergeld sei ihm „zu peinlich“. Gerade habe er sich übergeben und sei umgekippt. Ich solle meine Schwester anrufen, um sein Treffen mit ihr abzusagen. Er habe Angst, dass sie wütend auf ihn sein könnte. Ich kann ihn nicht überzeugen, dass sie es verstehen würde. Ich kann ihn nicht überzeugen, dass ihm das Bürgergeld zusteht. Ich kann ihn nicht überzeugen, sich auch bei Jobs zu bewerben, die ihn nicht zurück in sein gewohntes Arbeitsumfeld führen.
Dieses Mal sagt er nicht, dass er mich lieb hat, bevor er auflegt. Vielleicht hat er ja jetzt verstanden, dass wir uns gar nicht mehr kennen – jetzt, wo er seine Arbeitslosigkeit offenbaren musste.
Zwischen uns stehen seine Abhängigkeit, Depressionen, Angststörungen und ein Tochter-Vater-Verhältnis voller Verschwiegenheiten. Seit Jahren denke ich über seinen Tod nach. Wann kippt er um und wacht nicht mehr auf? Oder wird er sein Leben eigenhändig beenden? Liegt er schon tot im Keller, wenn ich das nächste Mal anrufe?
Feigling ist der Schnaps auf dem Küchentisch und die Tochter, die diese Gefühle nicht äußert. Ich verstecke meine Wut gerade gut genug. Zu groß ist die Angst, dass es ihn verletzt, wie ich über ihn denke. Was, wenn meine Worte das Fass zum Überlaufen bringen? Würde mein Mut, mich von ihm abzugrenzen, mich zur Täterin machen?
Nach dem Anruf zittere ich am ganzen Körper, weine und zwinge mich dazu, aufzuhören, denn ich erwarte Besuch. Meine Knie bleiben stundenlang weich. Ich verbringe den ganzen Abend in Gedanken. Vor mir steht der Sekt, den ich brav mit Pfirsichsaft verdünne.
Ob meinen Vater loszulassen mutiger ist als festzuhalten, weiß ich nicht. Vielleicht, weil beides weh tut. Aber darüber zu reden, das ist der erste Schritt – egal, wohin er führt.
Etwa jeder elfte erwachsene Mensch in Deutschland ist Angehöriger einer suchterkrankten Person. Insbesondere Kinder von suchterkrankten Elternteilen sind psychisch gefährdet: Söhne werden eher selbst abhängig, Töchter leiden oft still. Suchterkrankungen sind also Familienerkrankungen.
Lange wurde für das Verhalten von Angehörigen der Begriff „Co-Abhängigkeit“ verwendet. Doch er ist umstritten, denn er ist weder wissenschaftlich klar definiert noch empirisch belegt. Eltern, Freunden, Arbeitskolleg*innen, Kindern und Partner*innen wird im schlimmsten Fall fälschlicherweise eine defizitäre Persönlichkeitsstruktur nahegelegt. Es wird die Botschaft vermittelt, ihr Verhalten gegenüber der suchterkrankten Person trage dem Suchtverhalten bei.
Diese generalisierende Schuldzuweisung untergräbt dennoch das Potenzial der Angehörigen, Teil des Heilungsprozesses der Erkrankten zu sein. Solange sie selbst ausreichend unterstützt werden. Doch die Schuldgefühle können Angehörige hemmen, selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Psychotherapeutische Hilfeleistungen sind zentral. Für HU-Studierende gibt es psychologische Beratungsstellen des Studierendenwerks und der HU. Auch Suchtberatungsstellen, wenngleich vielerorts überlastet, bieten Orientierung. Besonders Selbsthilfegruppen sind eine Chance, mit anderen Angehörigen Erfahrungen auszutauschen.
Illustration: Margarita Haas