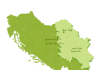Neben dem Rektor der Universität Belgrad, Vladan Đokić, erklären auch zahlreiche Professor*innen offen ihre Solidarität mit den Studierenden – was sie zur Zielscheibe für politische Angriffe macht. Wir haben mit dem Poltikwissenschaftler Slobodan G. Markovich von der Uni Belgrad über die Proteste, die politische Situation in Serbien sowie die Rolle der Professor*innen an den Universitäten gesprochen.
UnAuf: Studierende haben uns berichtet, dass die Meinungen der Professor*innen zu den Protesten geteilt sind. Wie haben Sie das in den letzten Monaten erlebt?
Slobodan Markovich: Es gibt eigentlich keine Trennung zwischen Professor*innen und Student*innen. Wir haben eine Meinungsumfrage durchgeführt. 95 Prozent der Studierenden, die sich aktiv an Protesten beteiligen, sind mit der Zusammenarbeit mit den Professor*innen zufrieden. Tatsächlich ist die Zahl der Professor*innen, die den Protest nicht unterstützen, so irrelevant, dass es schon überraschend ist. Es sind weniger als fünf Prozent. Der Staat hat zehn Namen von Professor*innen und fünf Namen von Studierenden. Diese 15 Namen werden seit neun Monaten herumgereicht. Kein einziger Neuzugang. Nichts. Dieselben 15 Namen neun Monate lang. Und das ist alles – die gesamte Unterstützung.
UnAuf: Die Regierung hat als Antwort auf die Proteste die Gehälter von Professor*innen stark gekürzt. In einem von Ihnen veröffentlichen Artikel haben Sie von fast 87,5 Prozent gesprochen. Wie wurde diese Maßnahme gerechtfertigt?
Slobodan Markovich: Es gab zwei Maßnahmen. Die erste wurde im Februar durchgeführt. Die Arbeitszeit von Universitätsdozent*innen teilt sich, in 50 Prozent Lehre und 50 Prozent Forschung. Die Regierung sagte: „Okay, ihr forscht, ihr haltet keine Vorlesungen.“ Also kürzten sie zunächst um 50 Prozent, änderten dann aber die Regelung: In einer 40-Stunden-Woche berechneten sie 35 Stunden für Vorlesungen und fünf Stunden für Forschung. Das Verfassungsgericht hat immer noch nicht entschieden, ob das legal war, obwohl alle glauben, dass es nicht legal war.
UnAuf: Die Professorin Katarina Rasulic hat uns berichtet, dass einige Studierende, aber auch Professor*innen, von den Medien gezielt angegriffen wurden. Haben Sie das Gefühl, dass es seit November letzten Jahres schlimmer geworden ist?
Slobodan Markovich: Das ist ein altes Problem, das besteht, seit die aktuelle Regierung an der Macht ist, also seit den letzten zehn Jahren. Normalerweise richteten sie sich gegen liberale Professor*innen, aber jetzt richten sie sich gegen jeden, der die Regierung nicht unterstützt. Drei Professor*innen meiner Fakultät wurden letztes Jahr angegriffen. Es gab Plakate mit ihren Namen und Gesichtern, wie auf Haftbefehlen, als wären diese Leute Verräter*innen. Es gibt außerdem eine große Kampagne gegen den Rektor der Universität und die Dekane. Das ist nicht nur eine Medienkampagne, sondern wird auch durch angebliche, kürzlich gegründete NGOs verbreitet. Diese NGOs wurden mit dem einzigen Ziel gegründet, verschiedene Dekan*innen und Direktor*innen wegen verschiedener mutmaßlicher Handlungen zu verklagen. Die Staatsanwaltschaft oder die Polizei müssen dann laut Gesetz Anhörungen organisieren, die zu Medienspektakeln gemacht werden. Im Grunde genommen erfüllen sie also keinen wirklichen Zweck. Die Polizei lädt diese Leute ein und spricht mit ihnen, zugespitzt formuliert, über das Wetter in Belgrad. In den regierungsnahen Medien wird nur berichtet, dass diese Leute von der Polizei verhört werden und eine Straftat dahinterstecken müsse.
UnAuf: Welchen Einfluss haben diese Kampagnen auf die gesellschaftliche politische Meinung in Serbien?
Slobodan Markovich: Ich denke, das ist individuell, jeder nimmt es anders wahr. Aber im Grunde ist Serbien eine tief gespaltene Gesellschaft und es gibt zwei parallele Realitäten. Das liberale Serbien hat im Grunde keine Ahnung vom anderen und umgekehrt. Die Menschen erhalten zwei völlig unabhängige Informationsquellen. Als lebten sie in zwei völlig verschiedenen Ländern, in zwei vollkommen unterschiedlichen Realitäten.
UnAuf: Wie könnten diese unterschiedlichen Gesellschaften Ihrer Meinung nach in Serbien vereint werden?
Slobodan Markovich: Ich glaube nicht, dass das Land in absehbarer Zeit vereint werden kann. Es spielt keine Rolle, wer an der Macht ist. Es wird tief gespalten sein. So ist es nun einmal. Es wird zwei Serbiens geben. Das ist übrigens ein regionales Phänomen. Ähnlich verhält es sich in Kroatien, Montenegro, Ungarn und Polen, Serbien ist also nicht der einzige Fall. Es gibt eine integrative und relativ offene Gesellschaft und eine sehr verschlossene, verängstigte Gesellschaft voller historischer Ungerechtigkeitsnarrative. Auch hinsichtlich des Alters unterscheiden sich diese beiden „Serbien“ stark. Das inklusivere Serbien ist jüngeren oder mittleren Alters. Das andere ist eher auf ältere Menschen ausgerichtet. Auch das Bildungsniveau ist unterschiedlich. So findet man im traditionellen Serbien vor allem Arbeiter*innen.
UnAuf: Glauben Sie, dass durch die Proteste mehr Menschen auf die Seite der Studierenden beziehungsweise auf die liberalere Seite treten?
Slobodan Markovich: Die Studierenden haben ja bereits Unterstützung von über 60 Prozent der Bevölkerung. Ich denke also, sie haben das Maximum erreicht. Sie sind durch ganz Serbien gezogen. Sie haben alle wachgerüttelt. Man sollte sich auch dessen bewusst sein, dass Serbien das Ergebnis der serbischen Bevölkerung und der serbischen Wählerschaft ist, und all dessen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Es gibt ganze Wellen von Einwander*innen, Exilant*innen, die Kroatien, Bosnien oder den Kosovo verlassen haben. Und diese Menschen sind stärker traumatisiert als andere. Daher wählen sie seltener inklusive liberale Parteien.
UnAuf: Welche Rolle spielen nationalistische Symbole wie die Nationalflagge bei den Protesten?
Slobodan Markovich: Die Studierenden haben uns in unserer Umfrage gesagt, dass sie nationale Symbole absichtlich an sich genommen haben, um zu zeigen, dass sie „uns“ und nicht der Regierung gehören. Wir sollten also stolz auf nationale Symbole sein, weil wir sie tragen. Und nicht, weil die Regierung es tut. Das war ein totaler Schock für die Regierung. Diese hatte ursprünglich versucht, die Studierenden als Verräter*innen darzustellen und sie mit Nazis zu vergleichen. Zu Beginn behauptete die Regierung, die Studierenden würden vom russischen Geheimdienst kontrolliert. Das funktionierte jedoch nicht, da alle russischen Behörden die Studierendenproteste verurteilten. Die serbische Regierung behauptete ebenfalls, es handele sich um eine vom Westen finanzierte Revolution. Aber wenn Studierende eine serbische Flagge tragen, wird es schon etwas schwieriger. Nach wiederholten Aufforderungen der EU-Außenminister*innen, Beweise vorzulegen, konnte der Staat dem nicht nachkommen.
UnAuf: Fahnen der Europäischen Union sieht man hingegen eher seltener. Welche Rolle spielt die Europäische Union in Serbien sowie in den Protesten?
Slobodan Markovich: Auf dem Westbalkan gab es eine Reihe von Staaten, die heute als Stabilitokratien bekannt sind. Stabilitokratien entwickelten sich im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts und sind zum Beispiel Nordmazedonien, Serbien oder Montenegro. In all diesen Ländern behaupteten die Staats- und Regierungschefs, sie seien sehr fähig und könnten wirtschaftlichen Wohlstand bringen. Und wirtschaftlicher Wohlstand war angesichts der griechischen Wirtschaftskrise für Brüssel und Washington sehr wichtig, weil diese Länder dann in der Lage waren, ihre internationalen Schulden zu bedienen. Dann sind Rechtsstaatlichkeit und damit verbundene Dinge vielleicht nicht so wichtig. Die EU hat das stillschweigend akzeptiert. Bei allen liberalen Akteur*innen – egal ob Studierende, Opposition, NGOs oder in der Wissenschaft – herrscht das Gefühl, die EU habe sich einfach nicht ausreichend mit der Rechtsstaatlichkeit befasst. Deshalb gibt es auch keine EU-Flaggen.
UnAuf: Glauben Sie, dass die meisten Menschen mit liberalen Ansichten den Beitritt Serbiens zur EU trotzdem als Ziel sehen?
Slobodan Markovich: Ich denke, es herrscht eine Ermüdung auf den Seiten Brüssels und der Region, die auf einer Gegenseitigkeit beruht. Je näher der Beitritt rückt, desto präsenter werden Spannungen und Diskussionen. Für alle Länder, abgesehen von Montenegro, sind es aber noch mindestens fünf bis zehn Jahre Verhandlungen und Harmonisierung. Den meisten Menschen ist also klar, dass das nicht so schnell passieren kann. Andererseits hoffen alle, dass die EU die Rechtsstaatlichkeit in der Region, nicht nur in Serbien, ernsthafter und konsequenter betrachtet. Und die jüngsten Reaktionen sprechen dafür.
UnAuf: Viele Studierende stellen sich gerade die Frage, wie es nach neun Monaten Protest weitergehen soll. Gibt es darauf eine Antwort?
Slobodan Markovich: Ich denke, jeder ist sich darüber im Klaren, dass angesichts einer so großen institutionellen Krise wie dieser die Organisation von Neuwahlen der einzige Ausweg ist. Daher glaube ich, dass es sehr schwierig sein wird, dieser Hauptforderung der Studierenden in naher Zukunft zu entgehen. Die Regierung möchte die Entscheidung so lange wie möglich hinauszögern. Aber ich denke, je länger sie die Entscheidung hinauszögert, desto schwieriger wird es für sie. Vielleicht hat sogar die Regierung ein Interesse daran, Wahlen zu organisieren. Ich denke, es ist realistisch, dass zumindest die Wahlen bis Ende dieses Jahres bekannt gegeben werden.
UnAuf: Wir haben mit Studierenden auch bereits über die Neuwahlen gesprochen. Viele von Ihnen sind aufgrund der Wahlmanipulation ziemlich besorgt. Was muss sich bei dieser Wahl ändern?
Slobodan Markovich: Bei den letzten Wahlen 2023 war die allgemeine Schlussfolgerung von Wahlbeoachter*innen der EU, dass die Wahlen zwar frei, aber nicht fair waren. Es gibt verschiedene Arten der Manipulation. Die Wählerlisten werden nicht regelmäßig aktualisiert. Viele Serb*innen leben im Ausland, in Deutschland und anderswo, sind aber trotzdem registriert, weil sie Staatsbürger*innen sind. Wenn sie dann in Deutschland sterben und ihre Familien keine Sterbeurkunde einreichen, bleiben sie dauerhaft in diesen Listen. Die Listen werden also grundsätzlich nicht aktualisiert und dann stellt sich die Frage, ob sie manipuliert wurden. Im Grunde ist es für alle, die daran teilnehmen, von entscheidender Bedeutung, überall Wahlbeobachter*innen zu haben. Ich denke, dass diejenigen, die die Oppositionslisten anführen, besser darauf vorbereitet sein werden als in der Vergangenheit. Alles, was Ende der 1990er Jahre dafür getan wurde, wie die Ausbildung von Wahlbeobachter*innen, wurde etwa Ende der 2000er aufgegeben. Die Leute sagten, es gäbe bereits Demokratie, das brauche man nicht. Jetzt muss man dieses ganze Netzwerk von Grund auf neu aufbauen. Aber ich glaube, es gibt Begeisterung und Enthusiasmus, um das zu erreichen.
Foto: Tobias Würtz