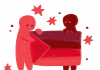Viele Student*innen leiden unter dem Leistungsdruck an der Uni, doch Unterstützung zu finden fällt nicht immer leicht. Auch Nick hatte Zweifel, ob seine psychischen Probleme „schlimm genug“ für eine Therapie sind. Wie er den Mut fand, sich Hilfe zu holen – und warum der Aufenthalt in einer Klinik kein Tabu sein sollte.
„Hey, du brauchst echt Hilfe.“ Für Nick war es dieser kurze Satz, der ihm klarmachte: So kann es nicht weitergehen. Er hatte gerade jemanden kennengelernt und war „Hals über Kopf verliebt“, erzählt er. Doch schon nach einer Weile fiel seiner damaligen Partnerin auf, dass sein Verhalten nicht nur die Beziehung, sondern auch Nicks Verhältnis zu seiner Familie und seinen Freund*innen belastete. Er hatte soziale Ängste, war unehrlich, reagierte empfindlich auf Stress und verschwieg seinen Eltern seit Jahren sein Kunststudium. Also suchte er sich Hilfe: Erst bei der Psychosozialberatung seiner Uni, dann bei einer Therapeutin und schließlich in einer Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.
Obwohl er in einem empathischen und sensibilisierten Umfeld lebte, zögerte Nick zunächst, einen Klinikaufenthalt in Erwägung zu ziehen. „Ich glaube, viele Personen, die sich zum ersten Mal in Therapie begeben, zweifeln daran, ob ihr Leidensdruck groß genug ist oder ob ihre Symptomatiken wirklich pathologisch sind“, erzählt er. Auch er habe sich vor seiner Behandlung ja immer irgendwie durchgeboxt. Die Klinik hatte für ihn früher mit Menschen zu tun, denen es erkennbar schlecht geht. „Mir fiel es sehr schwer, mich mit diesem Kranksein zu identifizieren – obwohl ich inzwischen denke, dass ein Klinikaufenthalt gar nicht damit verbunden sein muss, nicht ‚gesund‘ zu sein.“ Über seine eigene Diagnose möchte er nicht reden.
„Es gibt kein ‚zu kleines‘ oder ‚zu großes‘ Problem“
Diese Angst unter Betroffenen kennt auch Maria Zimmermann von der Psychologischen Beratung der Humboldt-Universität. „Es gibt kein ‚zu kleines‘ oder ‚zu großes‘ Problem“, betont sie. Gemeinsam mit einer Kollegin berät sie pro Monat 40 bis 50 Student*innen, die Unterstützung suchen. Die Herausforderungen seien vielfältig: „Häufig geht es um Prüfungs- und Leistungsängste, Prokrastination, Schreibblockaden oder Entscheidungsschwierigkeiten.“ Viele Student*innen kämen aber auch mit Selbstzweifeln, Identitätsfragen, Depressionen und Angststörungen zu ihr. In der Beratung zeige sich, ob eine psychotherapeutische Behandlung sinnvoll sein kann.
Nicks Therapeutin riet ihm, sich in einer Klinik vorzustellen. Bis er dort einen Platz bekam, musste er Geduld beweisen: Sieben Monate vergingen zwischen dem ersten Gespräch in der Uni-Beratung und der Aufnahme in der Station.
Ein Leben wie in einer anderen Welt
Prägend für Nicks Aufenthalt war die Tagesstruktur in der Klinik. „Um 6:00 Uhr wurden wir geweckt, 6:30 Uhr gewogen, 7:00 Uhr gab es Frühstück, 7:30 Uhr progressive Muskelentspannung – das hatten wir sogar zweimal am Tag.“ Dann waren die Einzelgespräche an der Reihe, vor- und nachmittags die Gruppentherapie. Dazwischen standen weitere Therapieformen wie Kunsttherapie, Bewegungstherapie oder Musiktherapie auf dem Plan. Dabei gehe es viel um soziale Resonanz, erzählt Nick. Die Musiktherapie helfe bei der Selbstwahrnehmung, „aber das lief immer in Verbindung mit anderen Menschen, die gerade auch auf Musikinstrumenten rumklopfen. Später in der Einzeltherapie habe ich oft über meine Erfahrungen dort geredet: Was macht das mit einem, wenn da ein Typ wieder so viel Raum einnimmt und laut lostrommelt?“
Die Klinik sei für Nick ein spezieller sozialer Raum gewesen, in dem Menschen sehr vorsichtig miteinander umgehen – ein abgeschirmter Mikrokosmos mitten in der Stadt. Sich danach wieder an das Leben außerhalb der Station zu gewöhnen, kann zur Herausforderung werden. Nick wechselte nach zwei Monaten in stationärer Behandlung in die Tagesklinik, kehrte also nach der Therapie abends und am Wochenende nach Hause zurück. „Das war ein guter Übergang, um mich so langsam wieder einzutakten, aber es war nicht leicht“, erzählt er.
Nach insgesamt elf Wochen schloss Nick seine Behandlung in der Klinik ab. In dieser Zeit ist er sehr weit gekommen, findet er. Gerade deswegen habe sich die Enddiagnose, die ihm zum Abschied ausgehändigt wurde, doch nochmal verletzend angefühlt. „Am Ende kriegst du diesen Zettel: ‚Du bist doch anders.‘“ Diese Ausgrenzung habe ihm erstmal zu schaffen gemacht: „Das hat einiges eingerissen, was ich mir davor aufgebaut habe.“ Eigentlich wäre Nick nach seiner Behandlung gern in Therapie geblieben, aber die Suche nach Therapeut*innen blieb erfolglos. Trotzdem entschied er sich, für ein Semester ins Ausland zu gehen. „Aus dem Erasmus bin ich zum Glück sehr stabil zurückgekommen“, erzählt er. Für Therapie habe er erstmal keine Notwendigkeit mehr gesehen, sein Studium konnte er regulär fortsetzen.
Student*innen sind besonders betroffen
Nick ist mit seiner Diagnose nicht allein: „Unter Studierenden treten psychische Erkrankungen häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung“, so Zimmermann. Unterschiedlichen Studien zufolge leidet ein Fünftel bis ein Drittel der Student*innen unter psychischen Erkrankungen. Auch in der HU-Studierendenbefragung von 2022 gab die Mehrheit der Befragten an, psychisch belastet zu sein.
„Der Übergang von Schule zu Hochschule, neue Lebensumstände, finanzielle Sorgen, Leistungsdruck oder der Versuch, Studium und das Kümmern um eine eigene psychische Erkrankung miteinander zu vereinbaren, können schnell zu Überforderung führen“, erklärt Zimmermann. Einerseits werde das Studium durch psychosoziale Belastungen wie Konzentrationsprobleme oder Erschöpfung oft erschwert. Andererseits würden der hohe Leistungsdruck oder finanzielle Sorgen unter Student*innen oft auch selbst zur Entstehung oder Verstärkung psychischer Belastungen beitragen – ein Teufelskreis. Mit der Beratungsstelle wolle man Betroffenen einen geschützten Raum bieten, um sich zu stabilisieren und neue Perspektiven zu entwickeln. „Wir ermutigen alle, sich frühzeitig Unterstützung zu holen“, betont die Therapeutin. „Niemand muss da alleine durch.“
Für Nick war es zunächst der Umgang mit sich selbst, den er in der Klinik neu erlernt hat: „Ich bin seitdem achtsamer und weniger streng mit mir selbst.“ Die neuen Verhaltensmuster konnte er dann auch auf seine Umwelt beziehen. „Im Anamnese-Bericht, also meiner Krankengeschichte, stand, dass ich sensibilisierter für die ‚Universalität des Leidens‘ bin“, erinnert er sich lachend. Inzwischen falle es ihm deutlich leichter, Hilfe anzunehmen, Bindungen zu stärken und für andere da zu sein.
„Was soll nur aus dem Jungen werden?“
Trotz seiner positiven Entwicklung trifft Nick nicht immer auf Verständnis, wenn es um seine Zeit in der Klinik geht. Seine Mutter befürworte die Entscheidung, aber „der Rest der Familie schweigt. Das wird unter den Tisch gekehrt.“ Kaum jemand habe gesehen, dass er aktiv an seinen Problemen arbeitete und welche Fortschritte er machte. „Die dachten sich: Es ist so schlimm, dass er sogar in der Klinik ist – was soll nur aus dem Jungen werden?“ Er hofft, dass sich dieses Bild einer Katastrophe verändert und stattdessen das Potenzial, das in einer Therapie liegt, in den Vordergrund rückt.
Nick selbst empfindet rückblickend viel Wertschätzung für seine Therapeutin in der Klinik und für das Gesundheitssystem, das ihm den Aufenthalt ermöglicht hat. Und er ist dankbar, dass Hilfe an so vielen Stellen angeboten wird. Auch wenn es schwierig sei, sich ein Problem selbst einzugestehen, könne man sich immer Unterstützung suchen – auch wenn man glaubt, die schweren Zeiten würden von selbst vorbeigehen. „Diese Hilfe ist für alle da.“
Foto: Mara Buddeke.