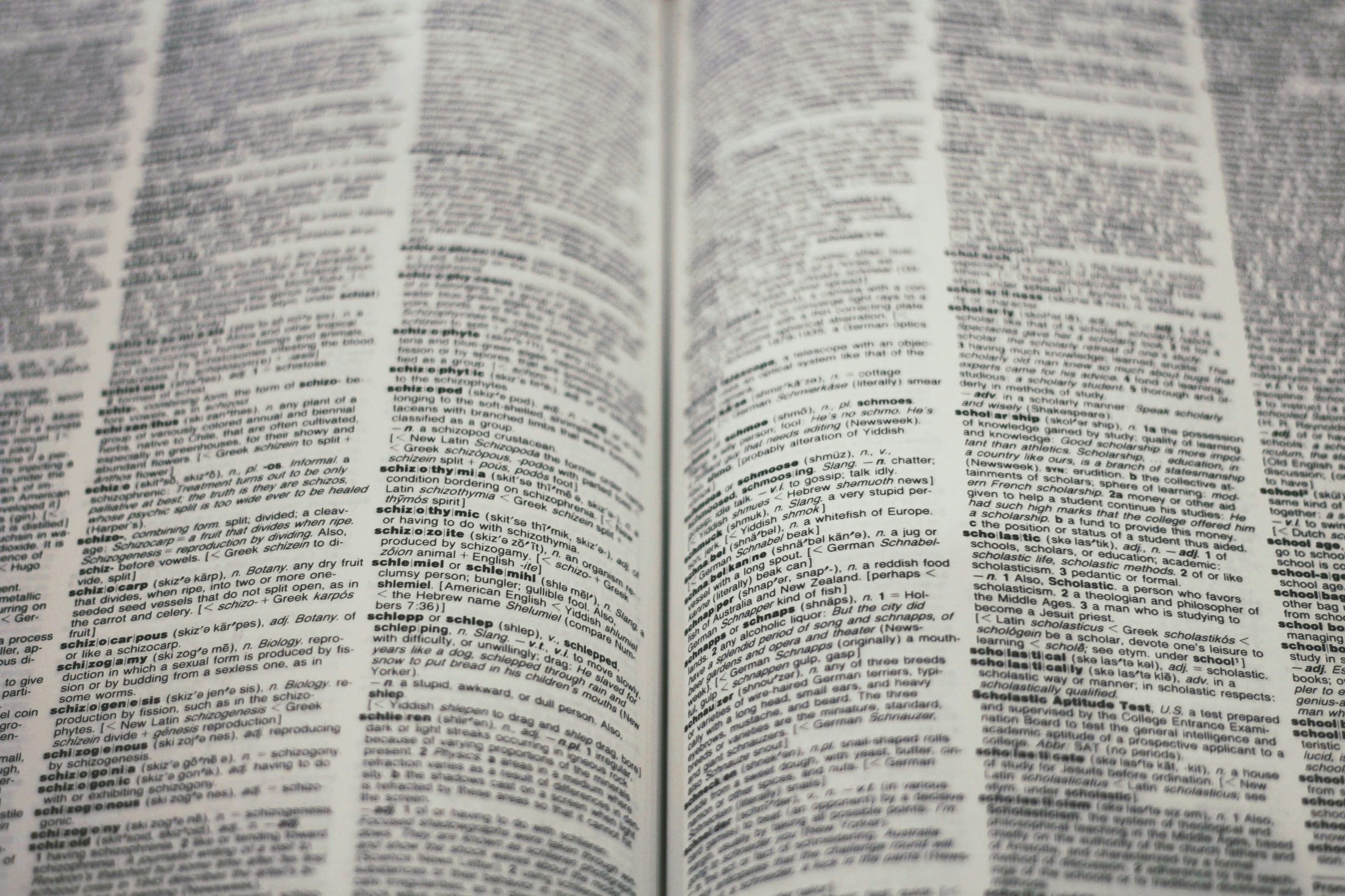Sagenumwobene Drachenbezwinger, sich in göttlicher Hingabe aufopfernde Märtyrer, als verfassungswidrig bezeichnete Aktivist*innen oder in die unerschlossene Weite des Weltraums aufbrechende Astronaut*innen – was alle genannten Figuren eint, ist das (ihnen gesellschaftlich zugeschriebene) Attribut des Mutes. Eine Normüberschreitung scheint der Maßstab dieser allgemeinen Charakterisierung zu sein, doch ist diese Auffassung längst veraltet. Ein Versuch der Neudefinition von Mut.
Die Definition der Brockhaus-Enzyklopädie besagt, dass es sich bei Mut um einen „über der Norm liegende[n] Einsatz zur Überwindung drohender Gefahr“ handele. Demzufolge sei nicht nur eine Gefahr charakteristisch, die quasi kämpferisch beseitigt werden soll, sondern vielmehr noch die betonte Normüberschreitung, welche einen mutigen Akt markiert.
Interessant ist hier bereits der Ausdruck „drohende Gefahr“, denn er setzt voraus, dass Handlungen erst dann als mutig gelten, wenn sie als Rückkopplung oder Re-Aktion angesichts einer existierenden Gefahr getätigt werden. Wenn eine Handlung außerdem erst dann mutig ist, sobald sie die Norm übertrifft, dann stellt sich die Frage, wo genau diese Norm denn überhaupt liegt und vor allem, wer sie als solche bestimmt. Ein Fallschirmsprung aus mehreren Kilometern Höhe mag sehr wohl ein mutiger Akt sein, und doch kann eine unter Höhenangst leidende Person ebenso viel Mut aufbringen, wenn sie von einem Findling am Straßenrand springt. Ab wie vielen Höhenmetern ist die springende Person also mutig? Liegt die Norm bei zehn, hundert, tausend Metern? Mut ist nicht messbar.
Darüber hinaus ist es immer wieder der Gedanke einer Überschreitung, der mitschwingt und einen Standard für mutige Handlungen festlegt. Heldensagen, Märchen und Actionfilme indoktrinieren absolut unrealistische Mut-Ideale (ja, man kann auch mutig sein, wenn man keine zehnjährige Odyssee oder Zauberduelle gegen nasenlose Schwarzmagier überlebt hat). Dieses Verständnis schließt kategorisch all diejenigen Fälle aus, in denen auch „unterhalb“ dieser Normgrenze Mut aufgewendet werden muss: Ein Anruf beim BAföG-Amt, ein nächtlicher Nachhauseweg oder das offene Einstehen für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, wenn einem das Gesetz dies versagt. Alles Dinge, die für einige vielleicht simpel und selbstverständlich scheinen. Und doch erfordern sie teilweise Unmengen an Mut, zumal sie von der Norm abweichen oder ihr sogar widersprechen.
Das Wort „Mut“ geht auf das althochdeutsche „muot“ zurück, was so viel wie „Gemüt(szustand)“, „Leidenschaft“ oder „Entschlossenheit“ heißt. Nehmen wir es als solches hin, ist Mutigsein ein Akt, der das Gemüt bewegt – der nicht selbstverständlich, nicht offensichtlich, nicht routiniert, nicht einfach ist. Der womöglich eine gewisse Menge Entschlusskraft erfordert, weil er aus Zweifeln und Angst hervorgeht. Das kann sowohl alltägliche Anrufe als auch lebensgefährliche Zivilcourage einschließen.
Ob oben genannte ausschweifende Handlungen Mut erfordern, soll hier gar nicht angezweifelt werden. Dass aber die bestehenden Normen infrage gestellt und mutige Grenzüberschreitungen auf allen Leveln und in allen Bereichen stattfinden können, sollte jedoch außer Zweifel stehen. Durch eine Abkehr der Verallgemeinerung und eine Zuwendung an einzelne Stimmen kann der Begriff Mut daher – ganz mutig – neu formuliert werden.
Foto: Joshua Hoehne.