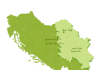Seit Monaten halten die studentischen Proteste nun schon an. Sie finden zwar im ganzen Land statt, aber reichen sie auch über die studentische Bubble hinaus und haben einen langfristigen Effekt auf die gesamte Gesellschaft Serbiens? Besonders wenn der Sommer ein leeres Belgrad und erschöpfte Student*innen mit sich bringt?
Dragoš, ein serbischer Musikstudent mit langen braunen Haaren Anfang 20 schüttelt energisch den Kopf, als ich ihn frage, ob er denke, die Studierendenproteste in Serbien würden noch etwas an der derzeitigen politischen Korruption im Land verändern. „Die Proteste gehen schon viel zu lange und es interessiert einfach keinen“, schreit er, damit man ihn trotz der dröhnenden Musik der Studierendenparty verstehen kann.
Schauplatz des Gespräches und der Party ist das Gebäude der technischen Fakultäten der Universität Belgrad. Es handelt sich nicht, wie oftmals in Berlin, um eine einfache Fachschaftsparty, sondern um einen Club, der in den Kellergängen des Gebäudes zu finden ist und auf Google-Maps als Klub studenata tehnike verzeichnet ist. Im Innenhof befindet sich sogar eine Bühne mit DJ-Pult, von der aus serbische Hip-Hop-Musik gespielt wird. Mit einer Berliner Studierendenparty ist das nicht zu vergleichen. Es gibt mehrere Floors, auf denen sich dutzende Student*innen tummeln. Die Szenerie lässt wenig auf die derzeitige politische Situation schließen, an der diese Student*innen einen hohen Anteil haben sollten. Feiern sie so ausgelassen, weil sie gar nichts mit den Protesten zu tun haben, die Proteste so gut laufen, dass man feiern kann oder weil die Student*innen resigniert haben? Dragoš Eindruck lässt auf letzteres schließen.
Er erklärt, dass es gerade den Versuch gebe, die zwei Klassen der Student*innen zu vereinen: diejenigen, die nur protestieren würden, um nicht studieren zu müssen, und diejenigen, die nicht protestieren würden, um studieren zu können. Er steht im Durchgang von einem Floor zum anderen und lässt hin und wieder Student*innen vorbei, während er redet. „Aber meine größte Sorge ist, dass wir uns von einer Person aus unseren Reihen manipulieren lassen, dieser oder diese in die Politik geht und den Opportunismus der letzten Jahren nur fortführt.“ Was bei Dragoš mitschwingt, ist in der Tat eine Resignation oder demoralization, wie er sie nennt und ein großes Misstrauen gegenüber der Politik, dabei sind aber nicht nur die korrupten Politiker*innen wie Serbiens Präsident Aleksandar Vučić gemeint, sondern institutionalisierte Politik im Allgemeinen.
Die zwei Bauingenieurwesen-Student*innen Isadora und Sonja, die kurz vor ihrem Fakultäts-Plenum, das seit Beginn der Proteste drei Mal die Woche stattfindet, mit uns reden, spiegeln zwar keine ähnliche Resignation wie Dragoš wider, denn: „Die Proteste nehmen kein Ende. Wir haben unsere Hoffnung nicht verloren. Wir haben viele neue Ideen und arbeiten gerade an ihnen“, verdeutlicht Isadora. Jedoch schwingt eine gewisse anti-politische Einstellung in der Aussage mit, dass die Proteste eben auch deswegen noch anhalten würden, weil sie ausschließlich von studentischer Seite aus organisiert und angeführt würden und die politische Opposition keine wichtige Rolle spiele.
Die Oppositionspartei Zeleno Levi Front (dt. Grüne Linke Front) ist dennoch auf der Seite der Student*innen, erklären die beiden Parteimitglieder Iva Puzović und Aleksa Prelić in ihrem Belgrader Parteibüro.
Der Studentische Protest: Die Oppositionspartei
Unweit von dem Gebäude der technischen Fakultäten befindet sich in der Nebenstraße Patrijhara Gavrila das Büro von Zeleno Levi Front, in dem auch Iva Puzović und Aleksa Prelić arbeiten. Mit dem Fahrstuhl im dritten Stock des Hauses angekommen, öffnet ein Mann in seinen Dreißigern die Tür. Aleksa sei gleich da. Direkt im Eingangsbereich des Parteibüros steht ein Tisch an der Wand, auf dem sich Sticker und Anstecker türmen. Auf den Stickern ist ein roter, blutiger Handabdruck mit den Worten „Krave Su Vam Ruke!“, auf deutsch: „Deine Hände sind blutig!“ Dabei handelt es sich um eines der zentralsten Symbole der Proteste seit dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024, durch den 16 Menschen umkamen. Laut Protestierenden klebt das Blut dieser Menschen an den Händen Vučićs, seiner Partei SNS, der Serbischen Fortschrittspartei, und der gesamten korrupten Politik des Landes. Passend dazu liegt auf dem Tisch ein Anstecker mit der Aufschrift „Fuck SNS!“. Es scheint so, als spiele Zeleno Levi Front im gleichen Team wie die Student*innen.
Mit einem großen Lächeln, einer großen Portion Selbstbewusstsein und einem festen Händedruck betritt Aleksa Prelic den Eingangsbereich und geht in einen Nebenraum mit zwei Sesseln und einem Sofa. „Hier können wir reden“, sagt er. Die große Frage, die sich stellt: Inwiefern ist die Oppositionspartei Zeleno Levi Front Teil der Studierendenproteste?
Aleksa beginnt: „Das Praktische an den Plena der Student*innen ist, dass sie kein Gesicht haben. Jeder kann mitentscheiden und abstimmen, aber es gibt niemanden, auf den sich die Medien stürzen können – den sie dämonisieren können. Das ist bei uns anders, über uns wird seit 13 Jahren schlecht berichtet. Das ist ein Grund, warum die Student*innen nichts mit der Opposition zu tun haben wollen.“ Der Fokus der Medien auf Oppositionsparteien habe eine Antihaltung gegen Parteipolitik ausgelöst. In eine Partei einzutreten, irgendeine politische Veränderung durch institutionelle Arbeit bewirken zu wollen, sei unter den Student*innen schlecht angesehen. Man müsse schon einer Bewegung oder einem selbstorganisierten Bündnis beitreten. Er fasst zusammen: „Diese anti-politische Einstellung hat den derzeitigen Studentenprotest sehr geprägt.“ Aber ist Zeleno Levi Front trotz dessen in den Protesten involviert? Aleksa erklärt, dass sie von Beginn an da gewesen seien, um die Student*innen zu unterstützen, aber eben nicht offiziell als Zeleno Levi Front. Student*innen hätten auch den Wunsch geäußert, dass sich die Mitglieder von Zeleno Levi Front nicht durch Anstecker oder andere Logos zu erkennen gäben. Er erklärt: „Dort sind wir nicht Zeleno Levo Front, sondern Zivilist*innen, die an den Protesten teilnehmen. Es ist nicht erlaubt, von der Opposition zu sein, wenn man mit ihnen protestiert.“ Wie er das finde? Nicht gut. Er verstehe zwar, aus welchem Grund dies geschehe und die Student*innen hätten keine bösen Absichten, aber er wisse nicht, wie sich das auf den zukünftigen Protest auswirke, so ganz ohne Verbindung zur Opposition. Auch, dass es sich bei der aktuellen Forderung um Neuwahlen handele, obwohl die Student*innen nicht wissen würden, wie institutionalisierte Politik funktioniere, besorge ihn.
Das Gespräch wird unterbrochen, als Iva Puzović den Raum betritt. Sie entschuldigt sich für die Verspätung, es sei ihr ein Meeting dazwischen gekommen. Aleksa setzt die kleine, braunhaarige, gerade mal 26 jährige Frau lachend darüber in Kenntnis, dass er gerade über „diese Kinder“ geredet habe. Gemeint sind damit, die Student*innen, die gar nicht mal so viel jünger sind als Iva und er. Iva fügt hinzu, dass ein weiterer Grund, warum sich die Student*innen von der Opposition abgrenzen, ihre politische Inhomogenität sei. Sie seien in diesem Moment noch nicht dazu bereit, eine Seite im politischen Spektrum zu wählen. Laut Iva sei es ein großes Problem, dass es innerhalb der Bewegung keine Diskussion über die politische Richtung und grundsätzliche Streitthemen gebe, die sogar von Fakultät zu Fakultät schwanken würden, besonders wenn es zu einer Neuwahl kommen soll. Die beiden sind aber dennoch der Meinung, dass die Bewegung eine Tendenz in die rechte politische Richtung habe und nationale Stimmen auch Gehör erhalten, weil dies eben die Abbildung der tendenziellen eher rechten serbischen Gesellschaft sei. Während oder nach eines Krieges und einer ökonomischen Krise aufzuwachsen, biete den perfekten Nährboden dafür.
Sie verstehe auch wie Aleksa, dass die Student*innen sich von der Opposition fernhalten, „aber sie sind noch so jung und es sollte nicht allein an ihnen hängen, zu kämpfen. Diese Probleme gibt es schon, seitdem sie Kinder sind.“ Zudem finde einfach keine Kommunikation mit anderen Gruppen wie NGOs oder oppositionellen Parteien statt.
Aleksa erklärt: „Die derzeitige Situation ist, dass wir versuchen, uns ihnen anzunähern. Zu sagen, wenn ihr dafür bereit seid, mit uns zu reden, sind wir da.“ Ob das passiert, hänge davon ab, wie es mit der Bewegung und den Wahlen weitergeht.
Aleksa und Iva sind aber beide der Meinung, dass die Bewegung unwiderruflich etwas in Serbien und der Gesellschaft verändert habe. Die Menschen seien aufgewacht, würden endlich raus gehen und aktiv werden. Die Bewegung sei immer noch genauso stark wie am Anfang, weil die Menschen immer noch an sie glauben würden. Jedoch handele es sich um einen langen, politisch-gesellschaftlichen Prozess, bei dem niemand der „Freiheitskämpfer“ sei und sich Schritt für Schritt etwas verändern muss.
Der studentische Protest: Die Zivilbevölkerung
Um das Vojvoda Vuk Denkmal, einem serbischen Woiwoiden aus dem 19. Jahrhundert, tummeln sich Menschen mit Serbienflaggen, EU-Flaggen und welche, die das Symbol einer blutigen Hand auf sich tragen. Was auffällt: es scheinen nicht nur Student*innen zu sein. Menschen jeglichen Alters und Berufsgruppen scheinen Teil dieser Veranstaltung sein zu wollen. Hierbei handelt es sich um keinen Protest von Student*innen, sondern um einen, der von der restlichen Zivilbevölkerung organisiert wurde. Nachdem sich die Gruppe vor dem Denkmal versammelt hat, gibt es ein von außen unbemerkbares Zeichen: die Fahnen bewegen sich mit den Menschen auf die Straße und legen so den Verkehr lahm. Erst wirkt es so, als sei noch nicht ganz klar, was der nächste Schritt sei, doch dann laufen alle mit lauten Rufen in eine Richtung.
Tamara, eine Demonstrantin am Ende ihrer Dreißiger, erklärt: „Sie fordern, dass es Neuwahlen gibt.“ Der Protest sei von verschiedenen bürgerlichen Initiativen organisiert worden. Ziel der Route sind Wohnungen verschiedener SNS-Politiker*innen in Belgrad, um sie mit ihrer Korruption zu konfrontieren. Auf dem Weg zu einer dieser Wohnungen sagt Tamara: „Die Student*innen haben die Bewegung zwar begonnen, aber nach all den Monaten sind sie erschöpft. Das heißt, wir müssen ihnen jetzt unter die Arme greifen und den Protest fortführen.“ Plötzlich kommt die Menge ins Stocken. Taschenlampen leuchten auf und werden auf einen Balkon gerichtet. Wohl der Balkon eine*r SNS-Politiker*in. Die Stimmung heizt sich etwas weiter auf und „Fuck SNS“-Rufe werden immer lauter. „Das hier ist noch ein sehr friedlicher Protest“, meint Gavrilo, ein Freund, den Tamara dazu geholt hat, um über seine Arbeit zu sprechen. Er ist Fotograf und schirmt die Proteste von Beginn an ab. Auf Instagram hat er fast 39 Tausend Follower und Tamara bezeichnet ihn als „den berühmtesten und besten“ Fotografen Serbiens. Gavrilo erzählt, dass es eine wichtige Kraft mit sich bringe, dass die Bewegung sich gerade nur mit dem Feind Vučić und SNS auseinander setze und es keine Zerpflückung von innen gebe. Auch die nationalistischen Stimmen würden zwar innerhalb der Bewegung ruhig gehalten werden, aber dennoch gegen die Korruption mit auf die Straßen gebracht. Später werde man sich schon um die politischen Richtungs- und Institutionsfragen kümmern.
Auch wenn sich durch viele Gespräche bemerkbar macht, dass der Protest bereits viele Kräfte gekostet hat, schwingt die Hoffnung und Entschlossenheit in fast allen Stimmen mit, wobei sich eben manchmal als treibende Kraft abgewechselt werden muss.
Foto: Hannah Isabella Schlünder