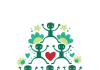Das CINS, das Zentrum für investigative Recherchen Serbiens, ist eines der einflussreichsten investigativen Medien in Serbien und deckte zum Beispiel im Jahr 2023 Wahlbetrug durch die Regierungspartei auf. Die UnAuf spricht mit der Journalistin Nina Čolić vom CINS über investigativen Journalismus, die Pressefreiheit in Serbien und die Rolle der Student*innenproteste.
UnAuf: Wieso hast du dich für Investigativ- und Videojournalismus entschieden?
Nina Čolić: Ich habe erst fünf Jahre lang bei einer Tageszeitung gearbeitet, mir war aber schon vorher klar, dass ich im investigativen Journalismus, an der Aufdeckung von Korruption und Verbrechen, arbeiten möchte. Bei meiner letzten Stelle habe ich im Bereich Social Media gearbeitet und TikToks produziert. Beim CINS haben Leute erkannt, wie wichtig eine Social-Media-Präsenz ist, und haben eine eigene Stelle dafür eingerichtet.
UnAuf: Hat sich die Pressefreiheit in Serbien seit dem Vorfall im November 2024 in Novi Sad verändert?
Nina Čolić: Ich glaube, dass sich die Polarisierung der Medien, die vorher schon sichtbar war, noch verstärkt hat. Neben den sogenannten objektiven Medien, die sich an einen gewissen ethischen Kodex halten, haben wir die regierungsfreundlichen Medien. Dort wird Falschinformationen gerne eine Plattform geboten. Teilweise haben diese Medien auch persönliche Daten von Student*innen, die an den Protesten beteiligt waren, veröffentlicht.
UnAuf: Wie setzt die Regierung unabhängige Medien und investigative Journalist*innen unter Druck?
Nina Čolić: Vor allem im NGO-Sektor hatten wir vor ein paar Monaten Razzien, bei denen die Polizei in Büros nach Unterlagen gesucht hat, die beweisen sollen, dass NGOs von der EU oder den USA bezahlt werden. Auf der anderen Seite stehen wir auch unter finanziellem Druck, da wir nicht staatlich finanziert werden, sondern auf Spenden angewiesen sind. Außerdem werden durch regierungsnahe Medien immer wieder Falschinformationen über uns veröffentlicht. Auch Klagen gegen NGOs oder Journalist*innen sind nicht ungewöhnlich.Wir stehen also jeden Tag unter konstantem Druck. Besonders habe ich das bei der Tageszeitung gemerkt, bei der ich gearbeitet habe. Beim CINS scheint die Regierung vorsichtiger zu sein, negativ über uns zu reden, da sie wissen, dass eine breite Masse uns als wichtiges und wertvolles Medium wahrnimmt.
UnAuf: Ist es schwierig, sein privates Leben vom professionellen Leben zu trennen, wenn man aufgrund seines Berufs unter ständigem Druck steht?
Nina Čolić: Es gibt keine Trennung mehr zwischen Privatem und Beruflichem. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen haben Kameras in ihren Wohnungen installiert oder überprüfen ständig, ob ihre Standortdaten von jemandem verfolgt werden. Wer in Serbien Journalist*in wird, ist sich bewusst, dass einem aufgrund der Arbeit etwas zustoßen kann. Als CINS eine Undercover-Recherche durchführte, die aufdeckte, wie die regierende Partei Wahlen manipuliert, musste die verantwortliche Journalistin nach der Veröffentlichung besondere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Sie musste aus ihrer Wohnung ausziehen, öffentliche Verkehrsmittel meiden und durfte niemals allein auf die Straße gehen, da die Reaktionen der Behörden oft unberechenbar und potenziell gefährlich sind. Eine solche Recherche nimmt dein ganzes Leben ein.
UnAuf: Wie beeinflusst investigativer Journalismus das politische Klima in Serbien?
Nina Čolić: Investigativer Journalismus in Serbien spielt eine entscheidende, aber schwierige Rolle. Durch die Aufdeckung von Korruption, Wahlmanipulation und Verbindungen zwischen Politik und organisierter Kriminalität schafft er öffentliches Bewusstsein und löst mitunter Proteste aus, während er zugleich internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Anstatt jedoch institutionelle Reformen anzustoßen, führt solche Berichterstattung häufig zu Druck auf Journalist*innen, was die Polarisierung zwischen regierungsnahen und unabhängigen Medien weiter vertieft. Ich denke, das sehen die Menschen. Für die Gesellschaft ist diese Art von Journalismus entscheidend, um zu verstehen, wo wir derzeit stehen.
UnAuf: Trägt die Angst vor der politischen Situation und einem möglichen Bürgerkrieg zu dem Verlust kritischer Berichterstattung bei?
Nina Čolić: Ich glaube, dass es kritische Berichterstattung eher fördert, als vermindert. Dass das Thema Bürgerkrieg in Serbien noch immer sehr lebendig ist, nutzen die regierungsfreundlichen Medien allerdings aus, um weiter Angst zu verbreiten. Es bestärkt also auf jeden Fall nationalistische Propaganda. Meiner Meinung nach fallen die Student*innen darauf aber nicht rein und zeigen, dass alle Menschen, unabhängig von Nationalität oder Religion, in der Bewegung für eine demokratischere Gesellschaft vereint sind.
UnAuf: Mit der Entwicklung der Student*innenproteste zu einer Massenbewegung nehmen teilweise auch Leute mit einer stark nationalistischen Ideologie teil. Wie berichtet man über eine Bewegung, die in sich selbst so gespalten ist?
Nina Čolić: Gute Frage. Bei dem Versuch, die Proteste als Ganzes zu repräsentieren, haben wir zum Beispiel Livestreams gemacht. Dabei haben wir beschrieben, was wir sehen, was wir riechen und was wir hören. Wir haben nichts analysiert. Für mich geht es bei den Protesten weniger um linke oder rechte Ausrichtungen und mehr um eine Veränderung unserer Institutionen. Es geht dabei nicht um Identität, sondern vielmehr um den kollektiven Willen, Institutionen zum Wohle aller Bürger*innen zu verändern.
UnAuf: Was für eine Art von institutionellem Schutz gibt es für Journalist*innen in Serbien?
Nina Čolić: Keinen. Die institutionelle Unterstützung, die serbische Journalist*innen in der Theorie haben, funktioniert nicht. Wenn Journalist*innen attackiert werden, bleibt der Fall bei der Polizei und bei den Gerichten meistens in irgendeiner Schublade liegen. Wir kriegen auch keine Informationen durch offizielle Institutionen. Systematische Unterstützung haben wir also gar keine.
UnAuf: Würde sich deiner Meinung nach etwas an der Pressefreiheit und der Rechtsstaatlichkeit in Serbien ändern, wenn die EU mehr Verantwortung übernehmen würde oder Serbien sogar Teil der EU wäre?
Nina Čolić: Da bin ich mir nicht sicher. Die letzten neun Monate sah es nicht so aus, als würde die EU versuchen, zu helfen. Auch die serbischen Student*innen scheinen wahrzunehmen, dass es von Seiten der EU aus eine Art stille Unterstützung Vučićs gibt. Das entspricht natürlich nicht den offiziellen Werten der EU. Wir könnten über die möglichen Hintergründe sprechen, wie das Interesse der EU an Lithium in Serbien. Eine konkrete Unterstützung von Seiten der EU, die nicht nur aus Worten besteht, ist auf jeden Fall nicht zu spüren.
UnAuf: Was macht dir sonst Hoffnung für die Zukunft Serbiens?
Nina Čolić: Ich finde, gerade befinden wir uns im Standby-Modus. Es wird niemals wirklich einfach für Journalist*innen sein, aber ich denke, wir müssen noch härter arbeiten, um an wichtige Informationen zu kommen. Ich glaube außerdem, dass Leute mehr im Bereich der Medien geschult werden müssen. Denn Propaganda wird sich dir nicht vorstellen und sagen: „Hey, ich bin Propaganda.“ Es ist wichtig, dass wir in Zukunft wieder ein demokratisches System haben, in dem auch Journalist*innen in einer besseren Lage sind. Diese Perspektive macht mir Hoffnung.
Foto: Gavrilo Andrić