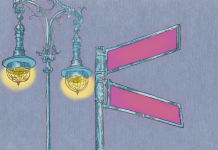Awareness-Teams schaffen in Berliner Clubs Räume der Fürsorge, mitten zwischen Rausch, engem Dancefloor und nächtlichen Ausnahmen. Sie sind da, wenn Menschen zu viel konsumiert haben oder wenn Grenzen überschritten werden. Ich spreche mit einem ehemaligen Awareness- und Drogenhilfemitarbeiter über seine Arbeit.
Die Tage werden kürzer, die Nächte immer länger und verleiten den Weg in die Clubs dieser Stadt. Darüber, ob Sommer oder Herbst die bessere Zeit ist, sich zwischen drückenden Bässen und Qualm zu bewegen, lässt sich streiten. Fest steht: Tanzen gehört in Berlin das ganze Jahr über dazu. Laut Clubcommission existieren hier rund 280 Clubs, andere Zählungen sprechen von bis zu 311. Und nicht nur Berliner*innen nutzen diese Räume: Rund drei Millionen Tourist*innen reisten 2018 allein für das Nachtleben, so die Clubcommission. Spätestens seitdem Berlins Technokultur im März 2024 Teil des Immateriellen Kulturerbes wurde, sollte klar sein: Techno ist längst mehr als nur Musik. Es ist gelebte Kultur, Ausdruck von Gemeinschaft und Kreativität.
Doch auch dies steht zunehmend in der Kritik. Sei es durch den Verlust seiner Wurzeln zur Schwarzen Community, die Kommerzialisierung oder den Umgang mit Drogen. Inmitten des bunten Chaos stehen Awareness-Teams, die versuchen, Fürsorge in einer Umgebung zu verankern, in der Ekstase und Erschöpfung so nah beieinander liegen.
Ich spreche mit einem 24-jährigen ehemaligen Awareness- und Drogenhilfemitarbeiter, der sich zwischen verschiedenen Clubs zwei bis drei Jahre lang um alle gekümmert hat, die es brauchten.
UnAuf: Was bedeutet Clubkultur für dich persönlich?
A: Zwiegespalten. Anfangs war alles neu, aufregend, lebendig. Doch mit der Kommerzialisierung ging viel verloren. Was mich noch berührt, sind die Solipartys, in denen hinter der Party eine Haltung steht. Das ist das Herz der Clubkultur: menschliche Verbundenheit und gemeinsames Aufbegehren.
UnAuf: Warum hast du angefangen, im Club zu arbeiten?
A: Als ich nach Berlin zog, war das alles neu für mich, diese Art, Freizeit zu leben, sich zu spüren, neue Gefühle zuzulassen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auch beruflich Teil davon sein will. Eine Freundin arbeitete im Awareness-Team und ich dachte, das passt. Ich arbeite gern mit Menschen, will wissen, wie es ihnen geht und wie ich sie unterstützen kann.
UnAuf: Was macht eine gute Awareness-Person aus?
A: Akzeptanz. Man muss Menschen in schwierigen Momenten annehmen, ihnen zuhören, verstehen, wo sie stehen. Und man braucht Empathie. Viele, die in Awareness-Teams arbeiten, kennen die Clubkultur auch von der anderen Seite: Sie wissen, wie man feiert, konsumiert, tanzt. Das hilft, Situationen besser einzuschätzen. Gleichzeitig muss man begreifen, dass kein Club ein sicherer Raum ist. Gewalt, Diskriminierung, patriarchale Strukturen gibt es auch hier. Awareness bedeutet, damit umgehen zu können.
UnAuf: Drogen spielen dabei eine große Rolle. Wie erlebst du ihren Platz in der Szene?
A: Der Rausch gehört zur Clubkultur. Menschen wollen spüren, loslassen, sich selbst neu erfahren. Manche Substanzen intensivieren das. Es ist ein Experimentieren mit Bewusstseinszuständen. Aber natürlich gibt es auch Schattenseiten: Verdrängung, Überforderung, Kontrollverlust. Und da kommen wir ins Spiel, um Menschen aufzufangen, wenn die negativen Seiten übernehmen.
UnAuf: Wie sieht das konkret aus?
A: Wir sind immer sichtbar mit Westen, auf denen „Awareness” steht. Die meisten wissen inzwischen, was das bedeutet. Wir werden gerufen, wenn jemand sich unwohl fühlt, übergriffig behandelt wurde oder einfach jemanden zum Reden braucht. Es gibt aber auch akute Fälle von Überdosierungen. Dann zählt Erfahrung: Was wurde konsumiert? Wie viel? Ist Mischkonsum im Spiel? Wir versuchen zu stabilisieren, bringen Betroffene in den Ruheraum, geben Wasser, beruhigen. Wenn nötig, holen wir Sanitäter*innen oder rufen den Krankenwagen.
UnAuf: Welche Substanz bereitet euch am meisten Probleme?
A: Ganz klar GHB oder G (auch Liquid Ecstasy genannt). Die Grenze zwischen „angenehm high” und „lebensgefährlich” ist extrem schmal. Viele unterschätzen das. Es passiert regelmäßig, dass Leute zusammenbrechen. Für uns ist das psychisch belastend, weil man nie weiß, ob jemand wieder aufwacht.
UnAuf: Hast du über die Jahre Veränderungen bemerkt, im Konsum oder in der Clubkultur allgemein?
A: Ja. Ketamin ist inzwischen Standard, G und Mephedron nehmen stark zu. Diese Drogen spiegeln auch gesellschaftliche Zustände wider: steigende Preise, prekäre Arbeit, Druck. Viele wollen am Wochenende einfach vergessen. Mephedron oder G halten dich länger wach, du kannst durchfeiern, dich frei fühlen, bis Montag alles wiederkehrt. Es ist ein Kreislauf aus Erschöpfung und Rausch.
UnAuf: Was gefällt dir an dieser Arbeit?
A: Der Kontakt mit Menschen. Wenn dir jemand sagt, dass er sich sicherer fühlt, weil du da bist, ist das unglaublich schön. Oder wenn du siehst, wie jemand, den du in einer Krisensituation betreut hast, später wieder vorbeikommt, dankbar, klarer, lebendig. Das macht den Unterschied.
UnAuf: Wie könnte eine wirklich fürsorgliche Clubkultur der Zukunft aussehen?
A: Sie müsste auf echten gesellschaftlichen Veränderungen beruhen. Ein System, das die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt, und eine Drogenpolitik, die auf Aufklärung und Entkriminalisierung setzt. Awareness sollte kein ausgelagertes Extra sein, sondern Teil des Miteinanders. Fürsorge beginnt auf der Tanzfläche, wenn wir alle Verantwortung füreinander übernehmen.
Illustration: Maiia Riabova