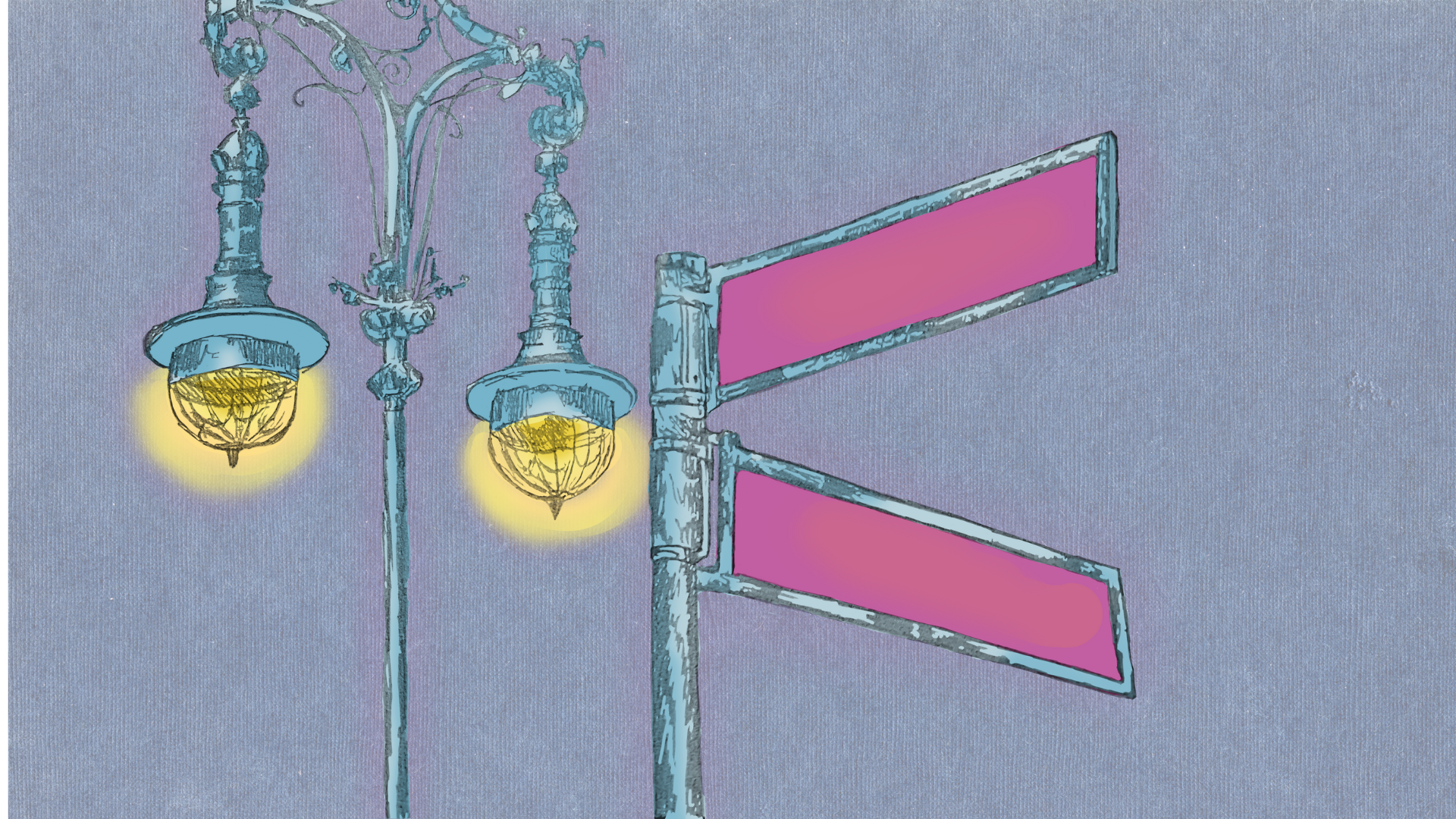Straßennamen dienen nicht nur der Navigation, sie verankern auch die Erinnerung an ihre Namensgeber im Stadtbild. Doch was tun wir, wenn es sich bei diesen um Menschen handelt, denen aus heutiger Sicht keine Ehre mehr gebührt?
Zwei Straßenschilder an einem Mast, das eine von ihnen schräg mit einem orangefarbenen Balken überklebt. So sieht es aus, wenn in Berlin eine Straße umbenannt wird. „Wir hätten gerne gehabt, dass das so bleibt. Aber das erlaubt uns das Gesetz nicht”, erzählt Mnyaka Sururu Mboro, an der Kreuzung der noch frischgebackenen Anton-Wilhelm-Amo-Straße und der Wilhelmstraße. Um ihn herum hat sich eine kleine Gruppe von Menschen versammelt und lauscht. Seit vielen Jahren führt Mboro, Mitbegründer des Vereins Berlin Postkolonial, durch die Berliner Innenstadt: Von einem mit Kolonialismus verknüpften Ort zum nächsten.
Wegen klirrender Kälte wird der Walk heute allerdings zu einem Talk. In einem Café erzählt Mboro neben seiner Jugend im postkolonialen Tansania, vor allem auch von den Straßenumbenennungen, welche seinen Verein und andere NGO seit vielen Jahren beschäftigen. Aus seiner Tasche zieht er laminierte Fotografien, die verschiedene Straßenzüge zeigen. Auf einem von ihnen ist das ehemalige Gröbenufer abgebildet. „Damit hat alles angefangen”, erinnert Mboro sich. Ursprünglich war das Gröbenufer nach Otto Friedrich von Gröben benannt, der Kolonien im heutigen Ghana gründete. Seit Februar 2010 ist die Promenade als May-Ayim-Ufer bekannt und erinnert somit an die afrodeutsche Dichterin und Aktivistin.
Für Mboro war die Umbenennung eine ganz besondere, auch weil er May Ayim selbst gut kannte. Als er als Student nach Deutschland kam, war sie es, die ihm von den kolonialen Straßennamen im Afrikanischen Viertel im Wedding erzählte. „Erst dachte ich, es ist doch ganz schön, dass sie Straßen nach Ländern, Städten und Flüssen in Afrika benannt haben”, sagt er. Doch dann erzählte sie ihm, dass es auch Straßen gab, die nach Kolonialherren benannt worden waren. „Als sie mir sagte, dass es eine Petersallee gibt, da wurden meine Knie weich”, erzählt Mboro. Schließlich wurde damit Carl Peters geehrt, der nicht nur die Kolonie „Deutsch-Ostafrika” im heutigen Tansania, Burundi und Ruanda begründete, sondern insbesondere auch für seinen Rassismus und seine Grausamkeit bekannt war. Während seiner Zeit als Reichskommissar wurde er von der Bevölkerung am Kilimandscharo auch als mkono wa damu (blutige Hand) bezeichnet. Mittels eines Disziplinarverfahrens wurde er schließlich seines Amtes enthoben.
Namen aus einer anderen Zeit
Trotzdem gab es laut Informationen der Bundeszentrale für politische Bildung Stand 2019 in Deutschland noch mehr als zehn deutsche Städte, die ihn mit einem Straßennamen ehrten. In Hannover steht bis heute ein Denkmal, welches, inzwischen durch eine die Kolonialherrschaft verurteilende Inschrift ergänzt, Carl Peters gewidmet ist. Errichtet worden war es nicht etwa zu Peters Lebzeiten, sondern im Jahr 1939 von den Nationalsozialisten. „Im Nationalsozialismus wollte man auch den Platz an der Sonne, den man nach dem Ersten Weltkrieg verloren hatte, zurückerlangen“, erklärt Mboro. Nicht wenige der Straßennamen, die ehemaligen Kolonialherren gewidmet sind, seien daher auf diese Zeit zurückzuführen. Auch die Berliner Petersallee fand erst 1939 zu ihrem Namen. Im vergangenen Jahr wurde sie nach jahrzehntelangem Engagement zivilgesellschaftlicher Akteure in Maji-Maji-Allee umbenannt. Damit gedenkt sie heute des Maji-Maji-Krieges, bei welchem sich die Bevölkerung des Südens „Deutsch-Ostafrikas” zusammenschloss, um gegen die deutsche Fremdherrschaft zu kämpfen.
Deutschlandweite Diskussion
Nicht nur in Berlin hat die Diskussion an Fahrt aufgenommen, auch in anderen deutschen Kommunen ist in den vergangenen 15 Jahren vermehrt über koloniale und rassistische Straßennamen debattiert worden. Im Jahr 2021 hat die Fachkommission Geoinformation, Vermessung und Bodenordnung des Deutschen Städtetages deshalb eine eigene Handreichung zu Straßenumbenennungen erarbeitet. Darin heißt es: „Die Straßenbenennung spiegelt stets die aktuellen Verhältnisse, die Weltanschauung und Kultur bis hin zu den Herrschaftsverhältnissen der entsprechenden Zeit wider.” Straßenumbenennungen sollen deshalb auch insbesondere dann möglich sein, wenn sich das Geschichtsbild verändert hat. Besonders die Verbreitung menschenfeindlichen Gedankenguts, Mitgliedschaft und Funktionen in diktatorischen oder kolonialistischen Strukturen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sollen heute Grund für eine Umbenennung sein. Ähnliche Erklärungen lassen sich in den Ausführungsvorschriften des Berliner Straßengesetzes finden.
Mittels dessen wurden in diesem Jahr etwa bereits die ehemalige M*-Straße nach jahrelangem Streit zur Anton-Wilhelm-Amo-Straße, sowie der Weddinger Nettelbeckplatz zum Martha-Ndumbe-Platz. Für den Verein Berlin Postkolonial ist all das ein großer Erfolg. Anderen geht ihr Engagement zu weit.
Nicht alle sind mit den Umbenennungen einverstanden
Mboro zieht ein weiteres laminiertes Bild aus seiner Tasche. Es zeigt ein Wahlplakat der CDU aus dem Jahr 2011. Abgebildet ist das Straßenschild der Kamerunerstraße, darüber und darunter steht: „Gegen Straßenumbenennungen im Afrikanischen Viertel. Darum CDU wählen”. Mboro wird beim Anblick auch heute noch wütend. „Wer hat denn gesagt, dass wir die Kameruner Straße umbenennen wollen? Keiner hat das gesagt”, erklärt er. Ziel sei es schließlich nicht, die deutsche Kolonialgeschichte aus dem Straßenbild verschwinden zu lassen, sondern sie kritisch zu kommentieren. Außerdem sollen statt den Kolonisatoren die Kolonisierten, und dabei insbesondere die Personen, die gegen die Fremdherrschaft kämpften, sichtbar gemacht werden. „Uns wird immer gesagt, wir wollten die Geschichte auslöschen, aber die Geschichte ist so zugedeckt, es gibt da gar nichts zu löschen”, bekräftigt Mboro.
Illustrationen: Diandra Shana Diekmann