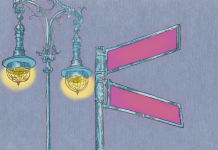Unser*e Autor*in zieht nach vier Jahren Bachelorstudium in Berlin in eine andere Stadt. Dey berichtet von deren Zeit in der Großstadt: Von Selbstfindung und Einsamkeit, Zugehörigkeit und Anonymität.
Atem dampft in der kalten Luft, als wir das Uni-Gebäude verlassen und zum Hegelplatz hinüberlaufen. Über den Grüppchen liegt Stimmengewirr und ein bisschen zu lautes Lachen. Die anderen Erstis halten sich an ihren Zigaretten fest, aber ich will nicht rauchen. Später lande ich mit ein paar Kommiliton*innen in einer Bar, die Stimmung ist nett und wir schaffen es, den ersten Smalltalk hinter uns zu lassen. Wir sind alle froh über diese Gruppe – jedoch nur für kurze Zeit. Die meisten von uns waren zu unterschiedlich. Ich freundete mich im Laufe der Zeit mit neuen Leuten an, mit denen es entweder auch nicht so ganz passte, oder das Commitment fehlte. Viele Studierende waren (gefühlt) auch schwer erreichbar. Es wirkt, als wüssten wir alle insgeheim, dass sich das nette Gespräch zwischendurch nicht „lohnen” würde, dass wir uns, unter den zahlreichen Studierenden, eh nicht wieder begegnen würden. Ich fühlte mich über einen längeren Zeitraum immer wieder einsam. Die Menschen waren da, aber nicht wirklich nah. Eine Erfahrung, die viele hier teilen und für die man sich nicht schämen muss.
In Lützerath waren Menschen, die mich anzogen. Im Januar 2023 war ich in dem Dorf in NRW, das für klimaschädliche Kohle abgebaggert werden sollte, um mit gegen die Räumung zu protestieren. Ich fühlte emotional, was zuvor mehr rational geblieben war: Die Gewalt des kapitalistischen Systems und den Willen, dagegen einzustehen. Als ich nach Berlin zurückkomme, nehme ich die Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, anders wahr. Und die Menschen, die keine Zeit haben, ihnen in die Augen zu schauen, kommen mir entfremdet vor – und verkleidet, denn sie sehen dabei so hip oder schick aus. Vielleicht können sie mit ihrem Style der Anonymität ein Stück weit entfliehen: Können auffallen, anstatt übersehen zu werden. Ich hatte in Lützerath Gemeinschaft erfahren und das stand für mich im starken Kontrast zu der bisher in Berlin verspürten Distanz. In mir war Neues entstanden – und das nahm ich auch mit in mein Leben in Berlin. Kurze Zeit später zog ich in ein linkes Hausprojekt. Mit der Zeit wurde dieser Ort ein richtiges Zuhause. Ich konnte mich verbunden und nah fühlen, hatte endlich einen Anker gefunden.
Vor ein paar Monaten traf ich eine Kommilitonin wieder, die auch Teil der zu Beginn erwähnten Erstsemester-Gruppe war. Berlin sei „character building” fanden wir. Hier treffen so viele verschiedene Menschen aufeinander. Wir müssen für uns selbst herausfinden, wer wir sein wollen und wo wir uns zugehörig fühlen. Es wird uns sehr wenig vorgegeben, vielleicht so wenig, wie nirgendwo sonst in Deutschland – außer eins: individuell zu sein.
Ich ziehe jetzt in einer Zeit weg, in der es besonders schön ist und mir ein paar Menschen in Berlin sehr wichtig geworden sind. Für mich passt gerade eine andere Stadt besser.
Ich wünsche euch, dass ihr in Berlin ankommen könnt und euch wohl fühlt. Dass ihr coole neue Erfahrungen macht in dieser Stadt, die nie stillsteht und, dass in manchen Momenten die Zeit doch stillzustehen scheint für euch.