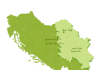Seit neun Monaten finden in Serbien Student*innenproteste gegen die Regierung Aleksandar Vučićs statt. Wie haben die Proteste sich entwickelt, welche Ziele verfolgen die Student*innen und was erhoffen sie sich für die Zukunft? Die UnAuf begleitet einen Studenten durch Novi Sad und schaut, wie es innerhalb der Protestbewegung aussieht.
Wir treffen Nikola Boca am Bahnhof von Novi Sad, dessen Vordach am 1. November 2024 einstürzte und 16 Menschen tötete. Hier liegen Blumen, Kerzen und Kuscheltiere als Zeichen der Erinnerung. Abgesehen davon scheint es fast, als hätte sich seit November 2024 kaum etwas verändert. Noch immer sieht man an dem Gebäude die Stelle, an der das Vordach abgebrochen ist, der Bahnhof ist seltsam still und leer. Ein Polizeiauto steht hier rund um die Uhr. Eine Polizistin verbietet uns, den Bahnhof zu filmen, kann uns aber nicht begründen, weshalb. Regelmäßig versammeln sich hier Menschen für 16 gemeinsame Schweigeminuten in Gedenken an die Verstorbenen. Das eingestürzte Bahnhofsvordach symbolisiert für einen großen Teil der Serb*innen die Intransparenz der Regierung und eine Vernachlässigung der zivilen Sicherheit. So wurde das Ereignis vor neun Monaten zum Auslöser der Protestbewegung gegen die autoritäre Regierung Aleksandar Vučićs. Den Anfang haben die Student*innen gemacht, darunter auch Nikola, der Informatik an der Universität Novi Sad studiert.
Vorher hat er sich kaum für Politik interessiert, jetzt nehmen die Besetzungen der Unigebäude und die Proteste und Plena so viel Raum in seinem Leben ein, dass er den Eindruck vermittelt, er wäre im politischen Aktivismus schon ein alter Hase. Im Gebäude der wissenschaftlichen Fakultät der Universität Novi Sad hat er zwischenzeitlich sogar fünf Monate gelebt. Oft habe er bis spätabends in Plena mit anderen Student*innen diskutiert und musste schon frühmorgens wieder da sein. Der Weg nach Hause hätte sich nicht mehr gelohnt.
Vor unserem Gespräch hat Nikola an einer Debatte über die anstehenden Klausuren teilgenommen, die eigentlich schon im Januar hätten beginnen sollen. Doch der normale Universitätsbetrieb ist seit Monaten stillgelegt. Sollte man den Protest pausieren und zumindest die Klausuren schreiben? Für Nikola mache es keinen Sinn, das Jahr nicht zu bestehen und viele Student*innen aufgrund der verlängerten Studienzeit in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. Er selbst müsse dann vielleicht sogar zurück in seine Heimatstadt ziehen und anfangen, zu arbeiten. Dennoch sind die Klausuren eine große Herausforderung, da die Professor*innen auf der Seite des Regimes die Prüfungen nicht an den Lernstand der Student*innen anpassen. In zwei Monaten alles nachzuholen, was man eigentlich in einem Jahr gelernt hätte, sei einfach unmöglich, so Nikola.
Staatliche Repression und Polizeigewalt
Mittlerweile sind nicht mehr alle Student*innen, die am Anfang der Proteste aktiv waren, durchgehend bei den Besetzungen dabei. Nikola verurteilt sie nicht: „Wir haben monatelang gekämpft.“ Tatsächlich haben die Student*innenproteste seit November 2024 eine solche gesellschaftliche und mediale Aufmerksamkeit erregt, dass sie sich über die Zeit zu einer Massenbewegung entwickelt haben. Dabei waren die Beteiligten oft staatlicher Repression und heftiger Polizeigewalt ausgesetzt. Nikola selbst bezeichnet sich als „Glücksbringer“, da er selbst noch keine Polizeigewalt erlebt habe. Er erzählt aber von Komiliton*innen, die aus unerklärlichen Gründen mehrere Stunden von der Polizei festgehalten wurden. Der Student und Fotograf Aleksa Stanković berichtet gegenüber dem CINS, dem Zentrum für investigative Recherchen Serbiens, wie er von drei Polizisten bedroht und aufgefordert wurde, seinen Instagram-Account zu löschen, auf dem er die Proteste dokumentiert. Sie sollen ihn geohrfeigt und seinen Kopf gegen eine Fahrzeugscheibe geschlagen haben. Hinzu kommt der mutmaßliche Einsatz einer verbotenen Schallwaffe auf einer Großdemonstration im März. Der BIA, der serbische Geheimdienst, der eigentlich der Bekämpfung organisierter Verbrechen und der Vorbeugung von Terrorismus dienen soll, habe laut Nikola außerdem Akten für einige Student*innen angelegt.
Wie kommt es, dass der serbische Staat die Demonstrant*innen wie Terrorist*innen zu behandeln scheint? Nikola beobachtet staatliche Repression in allen möglichen Lebensbereichen. „Wenn du hier kein Teil des Regimes bist, bist du ein Bürger zweiter Klasse“, sagt er. Wie reagieren die Familien der Student*innen auf diese Gewalt? „In Serbien sind gerade erst zwanzig Jahre des Friedens angebrochen, deswegen ist die Gewalt und auch das Thema Krieg noch ein sehr sensibles Thema. Viele Eltern haben Angst, ihre Kinder in einem Bürgerkrieg zu verlieren“, so Nikola.
Wir gehen vom Bahnhof in das Zentrum von Novi Sad, wo sich der Universitätscampus befindet. Bereits in der Innenstadt fallen uns einige Graffitis an den Wänden auf. Immer wieder taucht die rote Hand auf, welche an Blut erinnern soll und von Beginn an als Symbol der Student*innenproteste dient. Der Campus selbst ist belebt, obwohl abgesehen von ein paar Online-Veranstaltungen keine Kurse stattfinden. Nikola grüßt einige seiner Kommiliton*innen. Obwohl sich die Student*innen hier in einer absoluten Ausnahmesituation befinden, wird uns ein Gefühl von Alltag vermittelt. Transparente mit Slogans, zum Beispiel „Ingenieure schweigen nicht!“, hängen von außen an den verschiedenen Universitätsgebäuden, mit Kreide wurde eine 16 auf den Boden gemalt, symbolisch für die 16 verstorbenen Menschen. Auch hier auf dem Campus sehen wir immer wieder das Symbol der roten Hand.
Die serbischen Student*innen und die EU
Von hier aus ist Nikola im April 2025, im Rahmen der Aktion „blokadna pedala“, zusammen mit 79 anderen Student*innen, mit dem Fahrrad 1400 Kilometer bis nach Straßburg gefahren. Am 16. April, dem Tag nach ihrer Ankunft, veranstalteten die Student*innen einen Protest vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Europäischen Parlament. Nikola spricht über die Gemeinschaft, die über die Zeit zwischen den Student*innen entstanden sei. „Wir waren 80 Leute, die sich untereinander kaum kannten. Wir hatten viele schöne Momente zusammen, Berge, die wir hinter uns bringen mussten, kalte Tage und spaßige Bergabstrecken. Die Aktion hat uns auf jeden Fall zusammengebracht“, sagt Nikola. Da er selbst Leistungssport treibt, sei die Tour für ihn keine riesige Herausforderung gewesen, die Teilnehmer*innen hätten sich allerdings stets gegenseitig unterstützt.
Die besondere Protestaktion hatte das Ziel, die Aufmerksamkeit der Europäischen Union auf sich zu ziehen und die EU auf ihre Verantwortung für die Rechtsstaatlichkeit in Serbien aufmerksam zu machen. Die Frage, inwieweit Serbien auf die Hilfe der EU setzen kann und sollte, ist im Land sehr umstritten. Nikola erinnert sich besonders an ein Gespräch zwischen den Student*innen und einem EU-Repräsentanten. „Während er sich angehört hat, was wir zur Repression und Gewalt in Serbien erzählen, merkte ich, dass er nicht verstehen konnte, wovon wir redeten. Für jemanden aus einer gut organisierten Gesellschaft, dessen Staat einer gewissen Moral folgt, scheint die Korruption, die in Serbien passiert, unvorstellbar zu sein. Ich konnte es in seinen Augen sehen.“ Nicht nur Nikola zweifelt an der Fähigkeit und der Bereitschaft der EU, für die Interessen der serbischen Protestbewegung einzustehen. Im Nachhinein bereut er seine Teilnahme an der „blokadna pedala“ zwar nicht, bezeichnet den Protest aber als kontrovers.
Die NKPJ (Neue kommunistische Partei Jugoslawiens) geht in ihrem Statement zu den Protesten so weit zu behaupten, es handele sich bei den Teilnehmer*innen der „blokadna pedala“ nicht um echte Student*innen und es ginge ihnen ausschließlich um eine Anpassung Serbiens an den westlichen Imperialismus. Die deutsche „Kommunistische Organisation“ veröffentlicht dieses Statement uneingeordnet erneut. Student*innen wie Nikola, die zwar selbst an der „blokadna pedala“ teilgenommen haben, das Verhältnis Serbiens zur EU aber auch kritisch sehen, zeigen, dass es Nuancen innerhalb der Bewegung gibt, bei denen sich eine differenzierte Betrachtung lohnt. Die Aktion habe zumindest, so Nikola, für eine größere Aufmerksamkeit in den internationalen Medien gesorgt, als es vorher der Fall gewesen sei.
Spaltung innerhalb der Bewegung
Wir betreten mit Nikola das Gebäude der wissenschaftlichen Fakultät. Im Foyer werden wir freundlich von den Student*innen empfangen. Hier liegen Flyer, Sticker und Poster mit Werbung und Informationen über die Proteste. Zwei Studentinnen sitzen an einer Art Empfang und notieren unsere Namen und Matrikelnummern. Doch das hier ist nicht nur ein Ort der politischen Organisation, es ist auch ein Ort zum Schlafen, zum Essen und ein Ort der Gemeinschaft. Nachdem unsere Daten notiert wurden, darf Nikola uns das ganze Gebäude von innen zeigen. Die Räume der besetzten Universität wirken wie ein großes, ungemachtes Bett, aus dem jemand frühmorgens aufgesprungen ist, um sich gleich wieder an die Arbeit zu machen. In den Hörsälen und Klassenzimmern liegen Matratzen, Schlafsäcke und Decken auf dem Boden. Ein Klassenraum wurde zu einer Küche umfunktioniert und gespendete Lebensmittel stehen ausgebreitet auf den Tischen. Im Eingangsfoyer sitzen Menschen, die miteinander reden und essen. Uns wird langsam bewusst: Das ist keine zeitweilige Besetzung eines Gebäudes, wie wir sie von Protesten an Berliner Universitäten kennen. Es ist ein Lebensmittelpunkt für die Student*innen.
Wir verlassen den Campus und Nikola zeigt uns den Platz der Freiheit. Hier hat der bisher größte Anti-Regierungsprotest in Novi Sad stattgefunden, organisiert und angeführt von den Student*innen. Doch die Bewegung ist schon lange über die Universitäten hinausgewachsen. Dass mittlerweile ein breiter Teil der serbischen Gesellschaft in den Protesten vertreten ist, sorgt auch für Kontroversen. Immer wieder findet auch eine nationalistische und rechte Rhetorik einen Platz, die sich stark von den eigentlich progressiven Ansätzen der Bewegung unterscheidet. Gerade die serbische Nationalflagge spielt hier eine Rolle. Die Student*innenbewegung hat von Beginn an die serbische Flagge genutzt, um nationale Symbolik nicht der Regierung Vučićs zu überlassen. Durch die Teilnahme nationalistisch eingestellter Menschen, die sich zwar gegen die Regierung, zum Beispiel aber für die Angliederung des Kosovos aussprechen, hat die Nutzung der Flagge bei den Protesten eine kontroverse und komplizierte Rolle angenommen. Laut Nikola haben die Diskussionen darüber, ob die Student*innen die serbische Flagge als Zeichen für sich nutzen sollten, wichtigere Themen in den Hintergrund gerückt. Da bei einem nationalen Protest immer Menschen verschiedener Ideologien und politischer Ausrichtungen zusammen kämen, sei die serbische Flagge auch etwas, was sie alle vertritt. Nikola mag sein Land und seine Leute und ist der Meinung, dass alle gemeinsam gegen die autoritäre Regierung Vučićs kämpfen sollten. Wie es danach weiter gehen soll, werde sich dann herausstellen.
Was bringt die Zukunft?
Vom Platz der Freiheit laufen wir mit Nikola zu einem Protest, der gerade stattfindet und sehen selbst ganz deutlich: Alle Altersgruppen, Gesellschaftsschichten und politischen Ausrichtungen haben im Meer der Flaggen, Banner, Warnwesten und blinkenden Lichter einen Platz. Aber wie viel Druck machen die Menschen der Regierung wirklich noch? „Die Proteste sind nicht mehr annähernd so wichtig, wie sie mal waren“, so Nikola, „Aber es ist wichtig, am Ball zu bleiben.“ Einerseits scheint also mittlerweile die Luft raus zu sein. Das liege daran, dass der Regierung die Proteste egal seien und auch ein großer Teil der Gesellschaft nicht angemessen reagiere, wie Nikola findet. „Teilweise beschweren sich Leute über unsere Blockaden, weil sie morgens mit dem Auto unterwegs sind und wegen uns zu spät kommen. Sie verstehen einfach nicht, dass es hier um etwas geht, das wichtiger ist als ihr Weg zur Arbeit“, so Nikola.
Manche Formen der Demonstration, wie die regelmäßigen Protestmärsche, findet Nikola mittlerweile selbst etwas ineffizient. Den größeren Sinn der Proteste sieht er darin, dass weiterhin große Massen aktiv im Kampf für die Freiheit Serbiens bleiben. Der Fokus der Student*innen liege jetzt auf der Forderung vorgezogener Parlamentschaftswahlen. Außerdem bilden sie Leute aus, die in Zukunft als Wahlhelfer*innen assistieren sollen, um Wahlbetrug seitens Vučić vorzubeugen. Nikola hofft, dass die neuen Erstsemester sich an den Protesten beteiligen und sie so nicht nur am Leben erhalten, sondern auch für neuen Wind in den Segeln der Bewegung sorgen.
Titelbild: Thordis Schreiber
Foto: Emely Stache