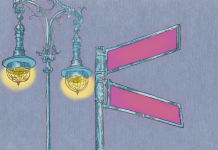Da hat man es mal aus der Heimatstadt rausgeschafft und sitzt nun mit Depressionen am Meer. Der Rapper Luvre47 zeigt auf seinem neuen Album Depression mit Meerblick eindrücklich, wie die Flucht vor sich selbst misslingen muss. Besonders für die Menschen, die eine Vergangenheit haben.
Könnten wir uns doch von unserer Heimatstadt trennen! Selbst bestimmen, was wir wo beruflich machen. Manch hochintellektuellen Einzelfall-Rebellen behaupten zwar immer noch, sie hätten sich von ihrer Vergangenheit gelöst und wären ihr eigener Chef geworden. Irgendwann werden sie es aber auch noch merken. Wir studieren nicht, weil wir selbstbestimmt sind. Wir studieren, weil uns unser Leben hierher gebracht hat. Unsere Herkunft bleibt für immer.
Das weiß auch Rapper Luvre47, der auf seinem neuen Album Depression mit Meerblick erzählt: Auch einen erfolgreichen Musiker, der bei 35 Grad am Strand liegt, lässt die Kälte der Straßen von Berlin-Gropiusstadt nicht los.
Eines der Kinder vom Bahnhof Zoo
Denn die Neuköllner Gropiusstadt ist kein Hipster-Kiez. Ursprünglich sollte hier eine Großwohnsiedlung entstehen. Auf den weiten Äckern des südlichen Zipfels von Berlin sollte genug Platz sein, um ein paar Hochhäuser bis in den Himmel zu ziehen. Die Situation verschärfte sich, als 1962 die Berliner Mauer gebaut wurde. Wo erst 15.000 Berliner*innen ihr Zuhause einrichten sollten, waren es plötzlich 50.000. Der Grund: Platzmangel. Das bedeutete höhere Häuser, weniger Grünflächen, mehr Infrastruktur. Wie es sich in der Wohnsiedlung leben ließ, kann man heute noch in Christiane Felscherinows Wir Kinder vom Bahnhof Zoo nachlesen.
Drogen verkaufen wird zur Berufsperspektive, Nachbarn kennt man nur von Ruhestörungen, Tourist*innen lohnen sich für Einheimische nur, wenn man ihnen den Geldbeutel abziehen kann. Seit 2002 ist die Siedlung ein anerkannter Ortsteil von Berlin-Neukölln. An den sozialen Problemen hat sich allerdings nicht viel geändert.
Auch nicht für Luvre47, der hier kurz vor der Jahrtausendwende geboren wurde. Das schreibt jedenfalls die Zeit 2021. Doch mit seinem Alter ist es wie mit allen anderen Informationen zu seinem Leben. Nichts ist sicher. Weder sein Alter noch sein echter Name. Das braucht ein Künstler nicht, der seine Texte für sich sprechen lassen möchte.
Luvre47 zwischen Selbstmördern und Freunden hinter Gittern
Das einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass er in Berlin-Gropiusstadt aufgewachsen ist. Und hier erzählt er von einer Welt, die in Trümmern liegt. Auf Hinterm Block erinnert er sich an einen Nachbarn, der aus dem zehnten Stock gesprungen ist. An Freunde, die hinter Gittern sitzen. Und an die eigene Zukunft, die von dem Geld abhängt, das er vom Drogenhandel erntet.
Immer schon schleicht ein tristes und hoffnungsloses Gefühl durch die Texte von Luvre47. Auf seinem neuen Album Depression mit Meerblick erreicht es den Rand des Ertragbaren. Dabei sollte man doch annehmen, ein gemachter Rapper könnte sich nun endlich mal ein großes Haus in Grunewald leisten. Regelmäßige Urlaube auf den Malediven oder Mallorca noch dazu. Doch leider zählt die sogenannte Überlebensschuld zur Berufskrankheit der meisten Rapper*innen. In teuren Autos sitzt die Vergangenheit auf dem Beifahrersitz und erinnert an alte Freunde ohne Geld. Einen von ihnen lässt Luvre47 auf dem Song Genug ist nie Genug zu Wort kommen: „‘Vielleicht zu viel verlangt‘, sagt Broski, der grad Thunfisch isst. Guter Junge, ehrlich, nur für ihn war halt die Schule nix”.
Die Flucht vor der Vergangenheit
Das Album spielt mit Bildern aus einer Welt, die sich der junge Luvre47 nie hätte erträumen können und mit einer Welt, an die sich der alte Luvre47 erinnern muss. „Kühlschrank leer und kein Gewissen zu gut gedeckten Tischen”, dichtet er auf dem Song Meeresrauschen. Ein Rauschen, das einem all das erzählt, von dem man sich so gerne trennen würde – wenn man denn könnte.
Denn genau das ist der Tenor des Albums. In einer 30-stöckigen Hochhaussiedlung gibt es keine Zeit, sich selbst zu finden. Es gibt keine Asienreise nach dem Abi oder ein Vermögen, auf dem man sich ausruhen kann. Wo Supermärkte rar sind, sind es Therapieplätze sowieso. „Drauf geschissen, wenn sie mein’n, man sieht mir an, ich müsst mal reden”, rappt Luvre47 auf dem Outro-Song Fundament. Es ist ja mittlerweile eine Binsenwahrheit, dass die eigenen Perspektiven von dem Kapital der Eltern abhängen. Doch das Album macht schonungslos klar: Es sind nicht nur die Perspektiven, es ist ein Lebensgefühl, das einen nie ganz loslässt.
Ein Lebensgefühl, das einem antrainiert hat, mit Enttäuschungen zu rechnen. Auf dem Zufriedenheit Skit erzählt Luvre47, er habe immer einen Zug nach vorne, einen unstillbaren Hunger. Es wirkt fast so, als wäre der Bauch für immer leer, wenn er einmal leer ist. Er endet mit dem Satz: „Zufriedenheit ist ’n ziemlich unkreatives Lebensgefühl”.
Musik ist keine Lösung
Traumatische Erfahrungen heilen nicht einfach so. Und wenn es keinen Therapieplatz gibt, dann muss wohl das Mikrofon im Studio herhalten. Im Straßenrap ist das ein gängiges Stilmittel. Der Rapper Kendrick Lamar hat auf seinem Album Mr. Morale & the Big Steppers jeden Song zu einer eigenen Therapiesitzung gemacht. In dem Musikvideo zum Song Count Me Out können wir regelrecht bei einer zusehen.
Doch wenn Zufriedenheit zu Unkreativität führt, was bleibt einem Künstler dann übrig? Wie es aussieht, nichts. Luvre47 rappt auf dem Song Meeresrauschen selbst: „Ich komm’ klar, treff mich im Paradies mit leeren Augen”. Er sieht in die Zukunft und sieht darin seine Vergangenheit, die sich mit scharfen Krallen an seine Versen heftet. Auch der Autor Franz Kafka schrieb einst über seine Heimatstadt: „Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat Krallen”. Die Herkunft, die einen nicht loslässt und die man nicht loslassen kann. Das Thema wird in kulturellen Kreisen wohl nie auserzählt sein.
Luvre47 macht sich währenddessen weiter zum Ausnahmerapper. Mit seinem dritten Studioalbum gehört er nicht nur zu den erfolgreichsten Rapper*innen der Szene, sondern auch zu den lyrisch anspruchsvollsten. Man kann nur gespannt bleiben, wo die Reise noch hingeht. Ans Meer wahrscheinlich nicht.
Foto: Mathias Reding