Unsere Autorin Eva Sieben hat in einem Kommentar die Forderungen der Initiative #NichtNurOnline als elitär und jammern auf hohem Niveau kritisiert. Unser Gastautor Roberto Lo Presti hält dem entgegen.
In ihrem Beitrag #NichtNurOnline: Fordern ja, aber mit mehr Solidarität betrachtet Eva Sieben die studentische Initiative, die eine Öffnungsstrategie für Hochschulen fordert, deutlich kritisch. Eine Inszenierung als Opfer der Gesellschaft und eine grundsätzlich unsolidarische Haltung werden der studentischen Initiative und den Lehrenden, die diese unterstützen, zum Vorwurf gemacht. Denn – so schreibt die Autorin – „wenn Akademiker*innen sich allen Ernstes hinstellen und proklamieren, sie würden von der Gesellschaft vergessen und an ihrer freien Entfaltung gehindert, kann man sich fragen, ob drei Semester Online-Lehre und Lockdown am Ende tatsächlich eine negative Auswirkung auf ihre Denkleistung bewirkt haben“.
Man könnte darüber diskutieren, ob diese Art und Weise kritisch zu argumentieren fair und überhaupt akzeptabel ist. Ich werde aber darauf verzichten und mir ein paar Bemerkungen und Klarstellungen zum inhaltlichen Kern der Kritiken erlauben.
Die Grundannahme, auf der der ganze Artikel zu beruhen scheint, und zwar, dass Akademiker*innen – pauschal betrachtet – zu den Privilegierten der Gesellschaft gehören, ist karikaturistisch und grundsätzlich falsch, weil Studierende keine undifferenzierte gesellschaftliche Gruppe darstellen. Ganz im Gegenteil ist die Universität – besonders in einem Land wie Deutschland, in dem die Studiengebühren sehr niedrig sind – eine der wenigen gesellschaftlichen Institutionen, die ein echtes Zusammentreffen von Menschen aus unterschiedlichen familiären und sozialen Milieus ermöglicht und fördert. Für viele Studierende, die weder zur Ober- noch zur Mittelschicht gehören und keinen akademischen Hintergrund haben, soll die Universität nicht nur ein Ort der Bildung darstellen, sondern auch und vor allem als Tor zur Gesellschaft dienen. Gleiches gilt für die von Jahr für Jahr zunehmende Anzahl von Studierenden mit Migrationshintergrund.
Sozioökonomische Ungleichheiten werden durch Pandemie verstärkt
In einem so vielschichtigen und komplexen Szenario haben die Aussetzung der Präsenzlehre und des Lesebetriebs der Bibliotheken über mehrere Semester und ihre Ersetzung durch rein digitale Bildung zur Folge, dass die sozioökonomischen Ungleichheiten zwischen Studierenden verschärft werden. Denn nur diejenigen, die zu den Stärkeren der Gesellschaft gehören, können mit dem digitalen Bildungsangebot zurechtkommen. Die anderen Studierenden – diejenigen, die prekäre Wohnverhältnisse haben und sich keine ausgezeichnete technische Ausstattung leisten können und diejenigen, die aus unterschiedlichsten Gründen die dauerhafte Isolation als psychisch besonders belastend erleben, können das digitale Bildungsangebot nur sehr eingeschränkt wahrnehmen und in einigen Fällen sind sie davon völlig ausgeschlossen.
Außerdem soll die Universität als Ort der sozialen Vernetzung dienen. Auch in diesem Fall führt ein rein digitales Bildungsangebot zu einer Verschärfung der Ungleichheiten, denn einige Studierende können sich auf die soziale Vernetzung der eigenen Familie stützen; für andere Studierende, die diese Möglichkeit nicht haben, stellen die Jahre des Studiums die Lebensphase dar, in der eine soziale Vernetzung von Null an aufgebaut werden soll.
In diesem Zusammenhang soll ein Missverständnis unbedingt vermieden werden: Wenn man von sozialer Vernetzung redet und den Mangel an sozialen Kontakten der Studierenden als ein dringendes Problem für die ganze Gesellschaft beschreibt, weist man nicht auf eine schöne Nebensache hin, sondern auf eine wesentliche Komponente jeder Art Lernens und auf einen unverzichtbaren Aspekt des gesellschaftlichen Bildungsauftrages der Hochschulen. Denn einerseits ist jede Art von Bildung – egal ob es um Schüler*innen, Auszubildende oder Studierenden geht – eine beziehungsbedingte Tätigkeit, die eine soziale Dimension voraussetzt. Ohne diese soziale Dimension wird Bildung zu einem passiven Erwerb und zu einer völlig unkreativen Speicherung von Informationen reduziert. Dafür aber braucht man keine Schule und keine Universität – Youtube reicht aus. Wer über „die freie Entfaltung der Person“ als vom rein digitalen Bildungsangebot gefährdetes Ziel der Bildung Witze macht, hat entweder von Bildung eine sehr eingeschränkte Vorstellung oder hält Bildung für gesellschaftlich irrelevant.
Andererseits erledigt die Universität ihren gesellschaftlichen Bildungsauftrag nicht nur dadurch, dass sie als Ort der Wissensschaffung und -vermittlung dient, sondern auch dadurch, dass sie als Ort der Kontroverse, des kritischen Denkens und des freien Debattierens gilt. Anders ausgedrückt: Die Universität ist ein politischer Raum und ein Ort der aktiven Bürger*innenschaft und somit wesentlicher Baustein demokratischer und kritischer Gesellschaften.
Wie verstehen wir als Gesellschaft Solidarität?
Wer in den letzten Wochen auf die schwierige Situation der Studierenden hingewiesen und mehr Aufmerksamkeit für ihr Leiden und ihre Nöte gefordert hat, weiß genau, dass dieses Leiden zumindest aus zwei Gründen gesellschaftlich relevant ist: Erstens, weil die dauerhafte Schließung eines politischen Raumes wie den Universitäten eine Gefährdung für die freie Gesellschaft darstellt, besonders wenn diese Schließung von einem großen Teil der Gesellschaft als unproblematisch wahrgenommen wird. Zweitens, weil der „schwächere Teil“ der Studierenden seit Anfang der Pandemie an den gesellschaftlichen „Kollateralschaden“ des digitalen Lehrangebots am meistens leidet.
Sich um dieses Leiden zu bemühen, hat mit einem ganz konkreten und nicht ideologischen Verständnis von Solidarität zu tun. Genau in diesem Verständnis von Solidarität liegt allerdings ein weiterer Vorwurf, mit dem die studentische Initiative #NichtNurOnline häufig konfrontiert wird. Denn verlockend erscheint der Vorwurf, die Studierenden seien „unsolidarisch“ und nähmen eine „jammernde“ Haltung ein. Diese Vorwürfe haben aber weitreichende Konsequenzen: Als ob in einer freien Gesellschaft eine Interessengruppe Schuld hat, Forderungen zu machen und gesehen werden zu wollen (wenn dieses Prinzip gälte, wäre ein großer Teil der gesellschaftlichen Funktion der Gewerkschaften völlig aufgehoben). Als ob die Forderung nach einer Strategie für die Wiederaufnahme der Präsenzlehre an den Hochschulen irgendwie in Konkurrenz mit anderen wichtigen und unterstützungswerten Forderungen anderer gesellschaftlichen Gruppen stände.
In diesem Zusammenhang finde ich ein von Eva Sieben vorgebrachtes Argument besonders gefährlich und ausgesprochen ungerechtfertigt: Denn sie fragt sich, warum die Gesellschaft, „in der es bisher mehr als 70.000 Corona-Tote und noch mehr Menschen in Trauer um ihre Verstorbenen gibt“ und die Gesellschaft, „die sich nicht für die vielen Geflüchteten in Moria oder die durch Hanau verunsicherten Menschen mit Migrationsvordergrund in ihrer Mitte verantwortlich fühlt, sich dafür Sorgen machen müsste, dass den Studierenden soziale Kontakte fehlen“. Diese Art und Weise zu argumentieren, die sich als kritisch und solidarisch verkaufen möchte, ist in der Tat ein gutes Beispiel von ideologischem und moralistischen Missbrauch des Solidaritätsbegriffes und würde, wenn man sie konsequent anwenden würde, zu einer formidablen Waffe für eine grundsätzlich autoritäre Stummschaltung jeder gesellschaftlichen Gruppe werden, die es wagt, etwas zu fordern.
Um ganz klar zu sein: Niemand, wirklich niemand will behaupten beziehungsweise hat behauptet, dass die Lage der Studierenden in der Pandemie mehr – oder auch nur gleiche – Aufmerksamkeit als die Corona-Toten oder die Geflüchteten in Moria verdient. Auch will niemand behaupten, dass die Lage der Studierenden schlechter als die vieler anderen gesellschaftlichen Gruppen sei. Es geht darum, die Gesellschaft einfach daran zu erinnern, dass es mit der dauerhaften Aussetzung der Präsenzlehre an den Hochschulen ein großes Problem gibt und dass es ein Jahr nach Beginn der Pandemie und Schließung der Universitäten dringend erforderlich ist, verantwortungsvolle Lösungen für den universitären Lehrbetrieb zu finden, die auch unter Pandemiebedingungen dem gesellschaftlichen Bildungsauftrag der Hochschulen gerecht werden.
Dr. Roberto Lo Presti ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Klassische Philologie der HU und unterstützt die Studierenden-Initiative #NichtNurOnline.



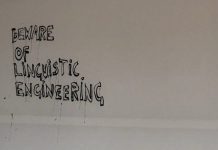






[…] Also interessieren sich auch Professor*innen für die […]
Comments are closed.